Organisation, Führung und mehr......

Mentale Belastung durch systemische Inkonsistenz – und was Führung ändern kann Mentale Belastung in heutigen Unternehmen ist allgegenwärtig: Change-Programme, volatile Märkte, Kostendruck, KI-Transformationen, Reorganisationen. Wenn Organisationen über mentale Belastung sprechen, richtet sich der Blick jedoch häufig reflexartig auf das Individuum: mangelnde Resilienz, fehlende Work-Life-Balance, unzureichendes Selbstmanagement. Entsprechend sehen die Maßnahmen aus: Achtsamkeitstrainings, Coaching, Gesundheitsprogramme, „besseres Zeitmanagement“. Das kann helfen aber oft bleibt der Effekt leider begrenzt. Denn diese Perspektive übersieht eine zentrale Ursache kognitiver Erschöpfung: Inkonsistenzen des Systems selbst. Nicht die Arbeitsmenge allein erschöpft Menschen, sondern die permanente Anforderung, sich in widersprüchlichen Strukturen und Signalen zu orientieren. Diese Sicht verändert, wo Führung ansetzen sollte: nicht primär am Menschen, sondern am Kontext. Mentale Belastung ist häufig keine individuelle Schwäche, sondern eine nachvollziehbare Reaktion auf strukturelle Widersprüche. Inkonsistente Erwartungen als kognitiver Stressor Organisationen operieren über Erwartungen: Rollen, Verantwortlichkeiten, Entscheidungswege, Erfolgskriterien. Erwartungen geben Orientierung. Sie reduzieren Komplexität und machen erkennbar, welches Verhalten in welchem Kontext anschlussfähig ist. Das Problem entsteht, wenn Erwartungen widersprüchlich sind – oder widersprüchlich wirken. Dann fehlt verlässliche Orientierung. Menschen wissen nicht mehr, woran sie sich halten sollen – nicht aus Unvermögen, sondern weil das System keine eindeutigen Erwartungssignale sendet. Typische Muster aus der Praxis: Eigenverantwortung wird gefordert, Entscheidungen werden jedoch zentralisiert. Innovation wird propagiert, Fehler werden jedoch sanktioniert. Vertrauen wird kommuniziert, gleichzeitig werden engmaschige Kontrollen ausgebaut. Kundenorientierung wird gefordert, belohnt werden jedoch interne Kennzahlen. Wertschöpfung wird verlangt, Strukturen fördern jedoch Selbstbeschäftigung. Solche Inkonsistenzen sind kein „weiches Kulturthema“, sondern ein Koordinationsproblem: Kommunikation und Entscheidungen funktionieren nur, wenn im jeweiligen Kontext erkennbar ist, welche Erwartungen gelten und welche Priorität sie haben. Nicht jede Mehrdeutigkeit ist schlecht: Ambiguität vs. Inkonsistenz Wichtig ist eine Differenzierung: Organisationen können nicht widerspruchsfrei sein – sie müssen oft Zielkonflikte gleichzeitig bearbeiten (z. B. Effizienz und Innovation). Mehrdeutigkeit kann sogar produktiv sein, wenn sie bewusst gestaltet wird. Drei Begriffe helfen zur Klärung: Zielkonflikt (legitim): Zwei Ziele stehen in Spannung (z. B. Standardisierung vs. Kundenspezifik). Ambiguität (handhabbar): Die Lage ist offen; es gibt Interpretationsspielraum – aber es gibt transparente Kriterien, Prioritäten oder Eskalationswege. Inkonsistenz (belastend): Das System sendet widersprüchliche Signale darüber, was „gilt“ – typischerweise als Muster „Wir sagen A, wir belohnen B“ oder „A wird gefordert, B wird sanktioniert“. Der Unterschied ist entscheidend: Ambiguität ist anstrengend, aber häufig bearbeitbar. Inkonsistenz erzeugt dauerhafte Orientierungskosten, weil sie die Frage offenlässt, welches Verhalten im System tatsächlich Anschluss findet. Warum das erschöpft: Set-Shifting als begrenzte kognitive Ressource Auf individueller Ebene lässt sich dieses Phänomen mit Konzepten der kognitiven Psychologie und Neurowissenschaft beschreiben. Ein zentraler Mechanismus ist Set-Shifting: die Fähigkeit, flexibel zwischen Aufgabenregeln, mentalen Modellen und Handlungsstrategien zu wechseln. Set-Shifting ist eine exekutive Funktion des Gehirns. Sie ermöglicht, Kontextanforderungen zu erkennen, alte Strategien zu deaktivieren, Verhalten an neue Regeln anzupassen. Entscheidend ist, dass diese Funktion sehr leistungsfähig ist, aber nicht unbegrenzt verfügbar. Jeder Kontextwechsel kostet kognitive Kapazität. Unter normalen Bedingungen regeneriert sie sich, unter Dauerlast wird sie schnell knapp. Inkonsistente Systeme wirken hier verschärfend. Wenn Erwartungen widersprüchlich sind, fehlen stabile Kontextsignale. Das Gehirn muss fortlaufend interpretieren: „Was gilt jetzt wirklich?“ „Woran werde ich gemessen?“ „Welche Regel setzt sich im Konfliktfall durch?“ Das erzeugt permanente Neuorientierung ohne Handlungsklarheit. Die Folge ist nicht „mehr Flexibilität“, sondern häufig das Gegenteil: Unter chronischer Überforderung exekutiver Funktionen steigt Stress, und Menschen greifen eher auf habituelle, rigide Muster zurück (Absicherung, Vermeidung, Rückzug, Mikropolitik). Das ist eine funktionale Schutzreaktion – aber für Organisationen teuer. (Organisationspsychologisch lässt sich dieses Erleben auch mit bekannten Phänomenen wie Rollenkonflikt, Rollenunklarheit und sinkender psychologischer Sicherheit beschreiben: Wo Sanktionen unvorhersehbar wirken, wird Exploration riskant und Kommunikation defensiv.) Kontextstringenz als Entlastungshebel Organisationen sind darauf angewiesen, dass ihre Mitglieder kontextsensitiv handeln. Dafür braucht es nicht Perfektion, aber Stringenz: Signale, die in sich stimmig sind oder Spannungen sichtbar und bearbeitbar machen. Kontextstringenz entsteht, wenn: Ziele priorisiert werden (zumindest situativ), Entscheidungsrechte klar sind, Mess- und Belohnungssysteme mit Aussagen und Strategien übereinstimmen, Konflikte nicht verdeckt, sondern als Spannungsfelder benannt werden. Damit sinkt nicht zwingend die Arbeitsmenge – aber die Orientierungsarbeit wird geringer. Aber genau diese Orientierungsarbeit ist häufig der unsichtbare Energiefresser. Ein Diagnose-Framework für Führung: „Sagen – Messen – Belohnen – Ermöglichen“ Bevor in Resilienzprogramme investiert wird, sollte Führung eine strukturierte Diagnose durchführen. Ein praxistaugliches Raster: Sagen wir (kommunizieren wir) A – aber leben wir B? (Narrativ vs. gelebte Realität) Messen wir A – oder messen wir B? (KPIs, Zielsysteme, Reportinglogiken) Belohnen wir A – oder belohnen wir B? (Boni, Anerkennung, Beförderungen, „wer gewinnt“) Sanktionieren wir A unbeabsichtigt? (Fehlerkultur, Eskalationen, „Bad News“-Dynamik) Sind Entscheidungsrechte konsistent mit Verantwortung? (Delegation vs. Zentralisierung; „Accountability ohne Authority“) Wo entstehen die meisten Kontextwechsel – und sind sie notwendig? (Parallelstrukturen, Doppelreporting, wechselnde Prioritäten) Welche Spannungsfelder sind real – und wie entscheiden wir im Konfliktfall? (Transparenz + Priorisierungsprinzip + Eskalationsweg) Dieses Raster erzeugt eine klare Führungsaufgabe: Inkonsistenzen eliminieren, unvermeidbare Spannungen explizit managen. Mini-Case: Von „Resilienzproblem“ zu Strukturarbeit Ein Bereich klagte über Überlastung und sinkende Motivation. Die Diagnose ergab: Offiziell: „Empowerment und schnelle Entscheidungen am Kunden.“ Real: Entscheidungen wurden in Gremien gezogen; Teams mussten jeden Schritt absichern. KPI-Logik: belohnt wurde „Planerfüllung“ und „Risikoarmut“, nicht Kundennutzen. Die Folge: Dauerndes Set-Shifting („Handle eigenständig – aber mach nichts falsch“). Mitarbeitende reagierten mit Rückzug und Absicherung: mehr Abstimmungen, mehr Mails, weniger Initiative. Die Intervention war nicht ein weiteres Training, sondern Strukturarbeit: Entscheidungsrechte wurden pro Entscheidungstyp definiert (Team / Führung / Gremium). Zwei KPIs wurden ersetzt: weg von interner Auslastung, hin zu Kundenergebnis + Lernfortschritt. Fehler wurden klassifiziert (lernfähig vs. vermeidbar) und Konsequenzen daran geknüpft. Spannungsfeld „Speed vs. Risk“ wurde als Prinzip geregelt (Default: Speed; Ausnahmen: definierte Risikoklassen). Ergebnis: weniger Kontextwechsel, mehr Klarheit, höhere Initiative. Die Arbeitsmenge sank nur moderat. Die mentale Last deutlich. Was das für Führung bedeutet Mentale Belastung ist nicht nur ein Personalthema, sondern häufig ein Strukturthema. Diese Erkenntnis verschiebt den Ansatzpunkt fundamental: Nicht primär Menschen stressresistenter machen, sondern vermeidbare Stressoren im Systemdesign reduzieren. Führung wird damit zum Kontextgestalter: Sie sorgt dafür, dass Erwartungen zueinanderpassen – über Abteilungen, Hierarchieebenen und Steuerungslogiken hinweg. Das erfordert keine Harmonie, aber: Transparenz über Spannungsfelder, klare Prioritäten, konsistente Signale in Kommunikation, KPI-Logik und Konsequenzen. Das ist unbequem, weil es Strukturarbeit verlangt statt schneller Interventionen. Aber es ist wirksam, weil es dort ansetzt, wo kognitive Kapazität tatsächlich verloren geht. Kognitive Kapazität ist eine wertschöpfungsrelevante Ressource. Jede unnötige Mehrdeutigkeit, jeder vermeidbare Kontextwechsel, jede widersprüchliche Botschaft verbraucht Set-Shifting-Kapazität. Erschöpfung ist deshalb ein diagnostisches Signal: Wenn Teams Zeichen kognitiver Überlastung zeigen, ist das nicht nur eine Information über individuelle Belastbarkeit. Es ist auch – oft vor allem – eine Information über die Struktur. Die Erschöpfung entsteht nicht allein im Menschen, sondern häufig zwischen Mensch und System. Und genau dort muss sie adressiert werden.

In der Debatte über moderne Führung gelten Macht und Hierarchie oft als Überbleibsel vergangener Zeiten. Viele verbinden sie mit Kontrolle, Abhängigkeit oder gar Unterdrückung. Doch diese Sichtweise greift zu kurz. Ohne Hierarchie fehlt Orientierung, ohne Macht fehlt Verantwortung – und ohne beides kann keine Organisation dauerhaft wirksam handeln. Agilität und Selbstorganisation werden gern als Gegenentwurf zu Hierarchie und formaler Macht verstanden. Sie stehen für Geschwindigkeit, Eigeninitiative und Flexibilität. Was geschieht, wenn jedes Team und jede Person völlig frei agiert? Der Vertrieb senkt Preise, um kurzfristig mehr Aufträge zu gewinnen. Das Marketing startet parallel eine neue Kampagne, ohne den Produktlaunch abzustimmen. Die IT stellt ein Systemupdate bereit, das mit den Prozessen im Kundenservice kollidiert. Jede Entscheidung für sich ist nachvollziehbar – zusammen führen sie zu Verwirrung, Mehraufwand und Reibungsverlusten. Was als Selbstorganisation beginnt, endet in Unkoordination. Diese Beispiele zeigen: Agilität braucht Struktur. Sie entfaltet ihre Stärke erst dann, wenn sie in ein System eingebettet ist, das Koordination ermöglicht. Und genau hier kommen Macht und Hierarchie ins Spiel – nicht als Gegenspieler moderner Führung, sondern als ihr Fundament. Hierarchie schafft Orientierung Hierarchie ist nicht gleich Macht. Sie ist zunächst eine Struktur, die Zuständigkeiten und Entscheidungswege festlegt. Ohne diese Ordnung verliert eine Organisation ihre Handlungsfähigkeit. Eine gut gestaltete Hierarchie sorgt für Klarheit: Wer ist wofür verantwortlich? Wo liegen Schnittstellen? Welche Entscheidungen müssen abgestimmt werden? Sie dient nicht der Kontrolle, sondern der Orientierung. Richtig verstanden bedeutet Hierarchie nicht, dass einige über anderen stehen, sondern dass alle wissen, wo ihre Verantwortung beginnt und wo sie endet. Sie ist das Rückgrat der Zusammenarbeit – sichtbar oder unsichtbar, aber immer wirksam. Macht ist Gestaltungskraft – und ein stabilisierendes Prinzip Auch der Begriff „Macht“ wird oft negativ besetzt. Dabei beschreibt er nichts anderes als die Fähigkeit, etwas zu bewirken. In jeder Organisation braucht es Menschen, die Entscheidungen treffen, Ressourcen lenken und Verantwortung übernehmen. Ohne Macht bleiben gute Ideen folgenlos. Aus systemtheoretischer Sicht erfüllt Macht in Organisationen eine entscheidende Funktion: Sie wirkt stabilisierend. Organisationen sind komplexe Systeme, die sich durch Entscheidungen selbst erhalten. Macht sorgt dafür, dass diese Entscheidungen überhaupt getroffen werden können – auch dann, wenn Interessen, Meinungen oder Perspektiven auseinandergehen. Sie reduziert Komplexität, indem sie Erwartungen strukturiert und Konflikte bearbeitbar macht. Macht ist also kein persönliches Privileg, sondern ein kommunikativer Mechanismus, der es ermöglicht, Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ohne Macht würde jede Abstimmung endlos dauern, jedes Projekt in der Diskussion verharren, jede Verantwortung im Kreis laufen. Erst durch Macht kann sich eine Organisation auf eine Richtung einigen – nicht, weil alle überzeugt sind, sondern weil sie eine gemeinsame Entscheidung akzeptieren. Natürlich kann Macht missbraucht werden. Doch das ist kein Grund, sie grundsätzlich abzulehnen. Missbrauch entsteht dort, wo Macht nicht durch Transparenz und Verantwortung gebunden ist. In einem gesunden System ist Macht keine Waffe, sondern ein Werkzeug – sie schafft Orientierung, Stabilität und Entwicklung zugleich. Struktur und Freiheit im Gleichgewicht Die Frage ist also nicht, ob Organisationen Hierarchie oder Agilität brauchen, sondern wie beides miteinander verbunden werden kann. Operative Entscheidungen sollten dort fallen, wo das Wissen liegt – im Markt, in den Teams, nahe an den Kundinnen und Kunden. Strategische Entscheidungen dagegen erfordern Überblick und Weitblick. Sie müssen zentral getroffen werden, damit das Unternehmen als Ganzes in eine gemeinsame Richtung steuert. Zwischen diesen Polen liegt die Koordination. Sie sorgt dafür, dass lokale Entscheidungen und zentrale Leitlinien zusammenpassen. Ohne diese Verbindung drohen Zielkonflikte, Doppelarbeit und Ineffizienz. Eine Organisation, die ihre Balance findet, ist schnell, ohne unkontrolliert zu werden, und strukturiert, ohne bürokratisch zu wirken. Ein Bild für Balance Man kann dieses Zusammenspiel gut mit einem Verkehrssystem vergleichen. Ampeln und Schilder regeln vor Ort den Ablauf, sie ermöglichen schnelle, situationsbezogene Entscheidungen. Gleichzeitig gibt es eine Verkehrszentrale, die das große Ganze beobachtet, Staus erkennt und bei Bedarf eingreift. Ohne Ampeln würde Chaos herrschen, ohne Zentrale fehlt der Überblick. Erst beides zusammen hält den Verkehr in Bewegung. So verhält es sich auch mit Organisationen. Die operative Ebene braucht Freiheit, um handeln zu können, und die Führungsebene braucht Struktur, um das Ganze zu steuern. Agilität und Hierarchie sind keine Gegensätze, sondern zwei Perspektiven derselben Wirklichkeit. Führung als Koordination von Verantwortung Führung bedeutet heute nicht mehr, Anweisungen zu geben. Sie bedeutet, Rahmen zu schaffen, Orientierung zu bieten und Entscheidungen zu ermöglichen. Führungskräfte sind keine reinen Entscheider, sondern Koordinatoren. Sie verbinden Wissen, Menschen und Verantwortung miteinander. Eine klare Hierarchie unterstützt diese Rolle. Sie macht Verantwortlichkeiten sichtbar und sorgt für Transparenz. Fehlt sie, entstehen informelle Machtstrukturen – oft unsichtbar, manchmal instabil, selten effektiv. Das Ziel ist also nicht, Hierarchien abzuschaffen, sondern sie bewusst zu gestalten: flach genug, um Beweglichkeit zu bewahren, aber klar genug, um Orientierung zu geben. Hierarchie als Infrastruktur der Zusammenarbeit Hierarchie ist kein Hindernis, sondern eine Infrastruktur, die Zusammenarbeit überhaupt erst ermöglicht. Sie funktioniert wie ein Kommunikationsnetz: Man bemerkt sie kaum, solange sie verlässlich arbeitet. Erst wenn sie ausfällt, zeigt sich, wie wichtig sie ist. In dieser Sichtweise schafft Hierarchie nicht Abhängigkeit, sondern ermöglicht Selbstverantwortung. Denn Verantwortung kann nur dort entstehen, wo sie klar zugeordnet ist. Ohne diese Zuordnung werden Entscheidungen beliebig, Verantwortlichkeiten verschwimmen, und niemand fühlt sich mehr zuständig. Struktur ist damit nicht der Feind von Freiheit, sondern ihre Voraussetzung. Macht als Verantwortung Macht ist kein Selbstzweck. Sie entfaltet ihren Sinn erst durch Verantwortung. Wer Macht hat, trägt die Pflicht, sie transparent und zum Wohle des Ganzen einzusetzen. In modernen Organisationen bedeutet das, Einfluss nicht zu horten, sondern zu teilen – Wissen weiterzugeben, Entscheidungsräume zu öffnen und Vertrauen zu stärken. Macht, die so verstanden wird, schafft Sicherheit und Entwicklung zugleich. Sie gibt Richtung, ohne zu dominieren, und schafft Stabilität, ohne Dynamik zu ersticken. Die Balance als Leitprinzip Erfolgreiche Organisationen verstehen Macht und Hierarchie nicht als Gegensatz zu Agilität, sondern als deren Voraussetzung. Sie finden eine Balance, in der Struktur und Freiheit sich gegenseitig stützen. Dabei geht es nicht um das Festhalten an alten Modellen, sondern um bewusste Gestaltung: Wie viel Struktur ist nötig, um Klarheit zu schaffen? Wie viel Freiheit ist möglich, um Kreativität zu fördern? Diese Balance ist kein fixer Zustand, sondern ein Prozess, der immer wieder neu austariert wird – in der täglichen Zusammenarbeit, in Führungsgesprächen, in Entscheidungen. Führung bedeutet in diesem Sinne, das Gleichgewicht zu halten: Orientierung zu geben, ohne zu ersticken, und Freiraum zu lassen, ohne Beliebigkeit zu riskieren. Und nun? Macht und Hierarchie sind nicht böse. Sie sind Bestandteile einer funktionierenden Organisation – neutral an sich, aber entscheidend in ihrer Anwendung. Ohne sie verlieren Unternehmen Richtung und Verantwortlichkeit. Mit ihnen entsteht ein Rahmen, der Orientierung, Effizienz und Vertrauen ermöglicht. Die Zukunft gehört Organisationen, die Macht als Gestaltungskraft und Hierarchie als Ordnungssystem verstehen. Beide zusammen bilden das Fundament wirksamer Führung – nicht als Gegensätze, sondern als Kräfte, die sich gegenseitig ergänzen und stabilisieren.

Warum es klug ist, Kunden- und Marktorientierung nicht in einen Topf zu werfen I hr Unternehmen ist doch sicher 100% kundenorientiert, oder? In meiner Beratungstätigkeit kreuzt immer wieder die Aussage „Wir sind ganz kundenorientiert“ meinen Weg. Und so nachvollziehbar diese Aussage auch auf den ersten Blick sein mag, so kritisch sollte sie in dieser Pauschalität einmal hinterfragt werden. Denn auch Marktorientierung kann – und ist in den meisten Fällen – eine sehr wirksame Ausrichtung eines Unternehmens. Wo liegt der Unterschied? Auf den ersten Blick klingt es fast gleich – Kundenorientierung und Marktorientierung. Zwei Begriffe, die oft als Synonyme durch Strategie-Meetings geistern, als ob sie dieselbe Denkweise beschreiben würden. Doch wer sich in der unternehmerischen Praxis bewegt, weiß: Zwischen beiden liegt ein Unterschied, der weit mehr ist als akademische Spitzfindigkeit. Es geht um die Ausrichtung ganzer Geschäftsmodelle – und letztlich um die Frage, wie Unternehmen heute überleben und morgen wachsen. Kundenorientierung ist wie ein maßgeschneiderter Anzug. Sie richtet sich an einzelne Bedürfnisse, an spezifische Wünsche und unmittelbare Erwartungen. Das kann charmant und effektiv sein, besonders dann, wenn es um langfristige Beziehungen, exzellenten Service oder die Entwicklung von Vertrauen geht. Doch wie jedes Maßstück hat auch dieser Ansatz seinen Preis: Zeit, Aufwand, Komplexität – und oft auch die Abkehr von Standards, die Skalierbarkeit ermöglichen würden. Wer hingegen marktorientiert denkt, schaut über den Tellerrand hinaus. Hier wird nicht gefragt: „Was will dieser Kunde heute?“, sondern: „Was braucht der Markt morgen?“ In diesem Denken stecken Wettbewerb, Trends, technologische Umbrüche, gesellschaftliche Veränderungen. Es ist eine breitere Linse, eine strategische Flughöhe, die es erlaubt, sich nicht nur zu bewegen, sondern zu positionieren – jenseits des direkten Kundenfeedbacks. Und warum ist das wichtig? Gerade Unternehmen, die mit wenigen Großkunden gewachsen sind, verfallen oft der Versuchung, jedem Wunsch gerecht zu werden. Was als Servicegedanke beginnt, endet nicht selten in einem gefährlichen Ungleichgewicht: individuelle Anpassungen, Sonderlösungen ohne Aufpreis, stille Abhängigkeiten. Und dann der Trugschluss, dass sich diese Leistungen später leicht an andere verkaufen lassen. Die Realität? Meist bleiben sie so spezifisch, dass ihr Wert außerhalb der ursprünglichen Kundenbeziehung verpufft. Das bedeutet nicht, dass Kundenorientierung schlecht ist. Im Gegenteil – sie bleibt ein zentraler Bestandteil jeder unternehmerischen Haltung. Aber sie darf nicht dominieren, wenn das große Ganze – der Markt, der Wettbewerb, die Zukunft – aus dem Blick gerät. Nur wer beides zusammen denkt, wer Kundenwünsche filtert, bewertet und in marktfähige Lösungen überführt, kann sich auf Dauer behaupten. Ein marktorientiertes Unternehmen entwickelt nicht für einen, sondern für viele. Es erkennt Muster statt Ausnahmen. Es kalkuliert wirtschaftlich, nicht emotional. Dabei bleibt der einzelne Kunde wichtig – aber eben als Teil eines größeren Systems, nicht als alleiniger Maßstab. Strategische Weitsicht beginnt also mit einem klaren Blick auf diese Unterscheidung. Denn während Kundenorientierung Nähe schafft, gibt Marktorientierung Richtung. Und wer beides beherrscht, hat mehr als nur einen Wettbewerbsvorteil – er hat einen Kompass in der Hand.

In den sehr frühen Tagen meiner Fliegerlaufbahn begegnete mir ein Phänomen, das unter Pilot:innen gleichermaßen gefürchtet wie lehrreich ist: PIO – Pilot Induced Oscillation . Damals, 1994, irgendwo unter der gleißenden Sonne Arizonas, absolvierte ich ein Auswahlverfahren, das über meine fliegerische Zukunft entscheiden sollte. Acht Wochen Flug-Theorie, Testflüge und mentale Belastungsproben – jede Sekunde zählte, jeder Fehler war ein Argument gegen mich. Schon bei den ersten Landungen geschah es: Nach dem Aufsetzen begann sich der Flieger unter mir zu wiegen, nicht sanft, nicht harmlos, oh nein! Durch eigene, überhastete Steuerimpulse brachte ich das Flugzeug zum Schlingern, das sich mit jeder Korrektur weiter aufschaukelte. Ein oszillierendes Drama, durch meine eigenen Füße ausgelöst. Mehr als einmal griff mein Fluglehrer rettend ein, als sich das Flugzeug der Kontrolle entzog und die Situation kippte. Ein einziges Mal nicht schnell genug reagiert – und es wäre zumindest einmal zu verbogenen Blech gekommen. Mit der Zeit – etwas Fokussierung und einem Schuss Demut – verstand ich, was hier geschah. Die Maschine reagierte nicht falsch, ich tat es. Zu früh, zu viel, zu unsicher. Ich lernte und disziplinierte mich , ruhiger zu bleiben. Vertrauen in das System zu haben und feinfühliger zu reagieren. Bewegungen nicht zu erzwingen, sondern geschehen zu lassen und dann eingeschwungen zu reagieren. Schließlich gelang die Landung – und mit ihr der nächste Schritt Richtung Pilotenschein. Was ich damals nicht ahnte: Das Phänomen – PIO - würde mir wieder begegnen. Ewige Jahre später, fernab jeder Landebahn, saß ich in einem Meeting – und das Schlingern begann von Neuem. Nicht im Flugzeug, sondern im Team. Ein anderes Cockpit, gleiche Dynamik. Als Führungskraft in einer neuen Rolle geriet ich in eine Schleife aus Mikromanagement und Kontrollzwang. Ein Projekt geriet ins Stocken, die Ergebnisse blieben hinter den Erwartungen. Unsicherheit kroch unter die Haut – und mit ihr der Drang, einzugreifen. Erst sanft, dann energischer, schließlich reflexhaft. Ich zog Meetings an mich, stellte Abläufe infrage, übernahm Kontrolle, drehte an Stellschrauben, wo keine zu finden waren. Doch statt Stabilität kehrte Unruhe ein. Das Team verlor Orientierung, Eigenverantwortung wich Rückzug. Wie einst im Flieger oszillierte das System – angestoßen von mir. Jede neue Maßnahme verschlimmerte das Ungleichgewicht, statt es zu beheben. Was einst PIO hieß, nannte ich nun MIO: Management Induced Oscillation . Die Parallele war frappierend. In beiden Fällen löste die übertriebene Reaktion das Problem aus, das sie eigentlich verhindern sollte. Nicht der Mangel an Kontrolle war das Problem, sondern ihr Übermaß. Nicht der Fehler des Systems, sondern das Misstrauen in seine Stabilität. Was mich diese Erfahrungen lehrte, wird oft im Organisationsalltag nicht verstanden: Systeme verfügen über ihre eigene Dynamik, ihre eigene Fähigkeit zur Selbstregulation. Wer ihnen diese Möglichkeit durch permanente Eingriffe nimmt, wird – trotz bester Absicht – selbst zur Quelle der Instabilität. Vertrauen, Raum, Geduld und ein tiefes Verständnis für das System sind keine passiven Tugenden, sondern Ausdruck souveräner Führungsstärke und ein Must-Have. Gerade in Zeiten erhöhter Komplexität ist es nicht das beherzte Eingreifen, das Wirkung entfaltet, sondern das kluge Ermöglichen von Wirkung. Manchmal ist das wirksamste Steuern eben genau nicht zu steuern. Der Impuls zur Korrektur ist auf den ersten Blick verständlich – aber nicht immer hilfreich. Wer Führung als ständige Intervention missversteht, löst genau jene Dynamik aus, die er verhindern will: Misstrauen, Rückzug, innere Kündigung. Je dynamischer ein System, desto weniger hilft Kontrolle und desto mehr braucht es strukturelle Gestaltung. Es geht nicht um das Beherrschen, sondern um das Gestalten jener Bedingungen, unter denen sich das System selbst intelligent justieren kann. Wer ständig am Ruder zieht, bringt das Schiff – oder das Flugzeug - aus dem Takt. Wer hingegen zuhört, beobachtet und gezielt lenkt, wird erleben: Der Flieger fliegt. Oft besser, als man denkt. Oder, wie mein Fluglehrer – Danke Dirk Stephan - es einmal lakonisch formulierte, als ich wieder überkorrigierte: „Der Flieger will landen. Du musst nur aufhören, ihn davon abzuhalten.“

Ich schreibe derzeit ein Buch. Ein Buch über Führung, Organisation – und den ganz normalen Wahnsinn dazwischen. Was sich dabei zeigt: Schreiben ist mehr als Tippen. Es ist ein ständiger Wechsel zwischen Klarheit und Suchbewegung, zwischen Fokus und Irritation, zwischen Struktur und Leere. Und genau das bringt mich zu einem Gedanken, den ich aus meiner Erfahrung als Pilot, Manager und Berater gut kenne – aber beim Schreiben noch einmal neu gespürt habe: Die meisten Probleme, mit denen wir uns beschäftigen, sind nicht einfach nur kompliziert oder komplex. Sie sind „komplexiziert“. Kompliziert? Komplex? Oder doch Komplexiziert? Der Begriff ist ein natürlich Kunstwort – zusammengesetzt aus Komplexität und Kompliziertheit . Man könnte es auch „ Zwei-Schicht-Problem “ nennen. Was ich im Alltag vieler Organisationen erlebe, ist eine wilde Vermischung beider Begrifflichkeiten. Leider führt das oftmals zu einem unklaren Umgang mit Problemen. Als Berater achte ich penibel auf Begriffsklarheit. Hier ein kleiner Exkurs in die Welt der Unterscheidungen: Komplex ist das, was wir nicht durchdenken können. Überraschend, dynamisch, mehrdeutig. Kompliziert ist das, was wir durchplanen können. Logisch, technisch, kalkulierbar. Diese grundlegende Unterscheidung ist nicht nur beim schreiben eines Buches wichtig, sondern vor allem im Führungsalltag. Die meisten Herausforderungen im Berufsalltag – ob Strategie, Probleme des Marktes und Kunden,Transformation oder Teamentwicklung – enthalten beides gleichzeitig . Sie sind eben „komplexiziert“. Das ist, was ich "Duale Wertschöpfung" nenne. Was das mit Schreiben zu tun hat Wenn ich an einem Kapitel sitze, beginnt der Prozess fast immer komplex: Ich weiß noch nicht, wie ich beginne. Ich suche nach dem Kern der Idee, ringe um Sprache, Struktur, Tiefe. Das braucht Zeit – und vor allem: kreative Präsenz . Erst wenn das Denkgerüst steht, wird es kompliziert: Jetzt geht es ums Schreiben, Redigieren, Glätten. Ein klarer Plan, eine konkrete Aufgabe. Disziplin statt Intuition. Würde ich diesen Unterschied nicht machen , käme ich auf die Idee, beim kreativen Hängen schneller zu tippen – oder mir eine neue Software zu installieren. Unsinnig? Ja. Und doch passiert genau das täglich in Unternehmen. Was das mit Fliegen zu tun hat Als Pilot kenne ich Situationen, in denen wir hoch standardisiert gearbeitet haben – zum Beispiel beim Start, Landung oder Checklistenführung. Alles ist durchdacht, trainiert, abgesichert. Komplizierte Abläufe – mit klarem Erfolgskriterium. Und dann gab es viele Situationen, in denen wir nichts planen konnten, nichts vorhersehbar war – etwa bei Einsatzlagen oder Entscheidungen in dynamischer Lage. Hier hilft keine Checkliste. Hier hilft nur: gutes Urteilsvermögen, klare Kommunikation, und gute Ideen. Wenn ich komplexe Situationen mit komplizierten Lösungen bekämpfen will, kann das gefährlich werden. Im Cockpit wie in der Führung. Warum das für Führung entscheidend ist In Organisationen beobachte ich häufig: Wenn der Druck steigt, greifen wir auf das zurück, was wir kennen – auf Wissen (das Komplizierte) . Mehr Prozesse. Mehr Tools. Mehr Meetings. Mehr KPIs. Doch wenn das Problem komplex ist , also offen, mehrdeutig oder neuartig – dann hilft das alles nicht. Wissen hilft nicht bei unbekanntem, neuem. Dann braucht es: Zeit für Denken statt Geschwindigkeit bei Umsetzung Räume für Ideen statt mehr Effizienz Fragen statt Antworten Komplexität lässt sich nicht organisieren. Sie will verstanden, durchdrungen und gestaltet werden. Was ich beim Schreiben (wieder) lerne Das Schreiben meines Buchs erinnert mich täglich daran, wie wichtig es ist, klar zu unterscheiden : Wo brauche ich Struktur – und wo Mut zum Ungeplanten? Wann hilft Disziplin – und wann Stille? Was ist tatsächlich das Problem – und nicht nur die Oberfläche? Drei Kernbotschaften für Führung und Organisation: Komplexität und Kompliziertheit sind nicht das Gleiche – und verlangen unterschiedliche Reaktionen. Gute Führung erkennt, in welchem Modus sie gerade operiert – und wechselt bewusst. Selbstführung ist die Grundlage – denn wer sich selbst nicht steuern kann, verliert in der Komplexität schnell die Orientierung. In meinem Buch widme ich genau diesen Fragen ein eigenes Kapitel – unter anderem aus der Perspektive von Pilot, Manager, Mensch. Denn am Ende gilt: Wer schneller tippt, schreibt nicht besser. Wer schneller handelt, führt nicht klüger. Und wer nicht weiß, in welcher Welt er sich bewegt, bleibt blind – auch mit perfekter Ausrüstung. I

Unternehmen lieben den Wandel? Nein, nicht so richtig! Meist kommt der Wandel über das Entwicklungsstadium einer PowerPoint-Präsentation nicht hinaus. Da stehen dann große Worte wie Transformation, Agilität, Kulturwandel. Es werden Leitbilder entworfen, neue Werte definiert und Workshops geplant, in denen alle gemeinsam beschließen, ab morgen anders zu arbeiten. Offener. Schneller. Innovativer. Leider währt aller guter Vorsatz nur kurz. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich diesen Ablauf als Führungskraft in einem Unternehmen nicht nur erlebt habe, sondern auch selbst so propagiert habe – aus Mangel an besserem Wissen. Doch wenn wir ehrlich sind, bleibt vieles davon nur schöne Symbolik. Manchmal sogar gut gemeinte Selbsttäuschung. Denn auch wenn intern alles auf „Change“ getrimmt wird, wirklich verändern tun sich Unternehmen durch dieses Vorgehen selten. Als ich als CEO ein Unternehmen geleitet habe, musste ich feststellen, dass Organisationen sich nicht verändern, nur weil man eine mitreißende Rede hält. Ich konnte appellieren, so viel ich wollte – das Unternehmen als Organisation änderte sich nur, weil der Markt es dazu zwang. Und auch das nur mit Widerstand. Den Grundsatz, dass Organisationen als autopoietische Systeme einen hohen Veränderungswiderstand erzeugen, musste ich am eigenen Leib erfahren. Nur der Markt kann Veränderungen erzwingen Die Illusion des freiwilligen Wandels Aus systemtheoretischer Sicht betrachtet, sind Organisationen geschlossene, selbstreferenzielle Systeme. Sie funktionieren nach ihren eigenen Regeln, beobachten sich selbst, entscheiden nach internen Logiken, lieben das, was sie kennen. Sie reproduzieren ihre Strukturen durch Kommunikation. Organisationen tun, was sie schon immer getan haben – solange sie können. Und sie ändern nur, was sie ändern müssen. Wenn es also heißt: „Wir brauchen eine neue Kultur!“, bedeutet das in der Praxis oft: „Wir hätten gerne das Gleiche wie bisher, nur mit etwas mehr Glanz.“ Oder: „Wir wollen etwas anderes – aber bitte nicht zu unbequem.“ Unternehmenskultur: Ein Produkt der täglichen Routinen Kultur ist kein Steuerungsinstrument. Kultur ist das Ergebnis dessen, was in einem Unternehmen täglich gesagt, entschieden und getan wird. Man kann sich keine Vertrauenskultur wünschen, wenn man gleichzeitig neue Kontrollsysteme einführt. Man kann keine Innovationskultur erwarten, wenn jeder Vorschlag durch fünf Hierarchiestufen genehmigt werden muss. Man kann keine Lernkultur fördern, wenn Fehler sofort eskaliert und sanktioniert werden. Was Organisationen tun, ist das, was sie sind. Und sie verändern sich nicht durch Wunsch – sondern durch Notwendigkeit. Der Markt als gnadenloser Change-Manager Diese Notwendigkeit kommt in fast allen Fällen von außen. Und zwar aus dem Markt – der relevanten Umwelt des Unternehmens, dessen Reize nicht ignoriert werden können oder zumindest sollten. Auch dafür gibt es Beispiele, nicht wahr, RIM. Solange Kunden zufrieden sind, Umsätze stabil bleiben und die Konkurrenz nicht bedrohlich agiert, gibt es keinen zwingenden Grund, Dinge zu verändern. Der Laden läuft ja. So, wie er eben läuft. Doch dann! Veränderungen im Markt.. Neue Technologien entstehen. Kundenerwartungen wandeln sich. Ein Wettbewerber denkt drei Ecken weiter und kommt plötzlich mit einer Überraschung um die dritte Ecke. Und plötzlich ist da Druck. Extern, spürbar, nicht ignorierbar. Jetzt kann Wandel passieren. Wenn, ja wenn… Die Kopplung an den Markt – warum Druck von außen Wirkung zeigt Der Markt verändert Unternehmen nicht direkt. Er schickt keine Anweisungen, hält keine Keynotes – so wie ich damals als CEO. Und doch ist er oft der einzige Grund, warum Organisationen sich wirklich bewegen. Warum? Weil sie – wie der bekannte Berater und Psychiater Prof. Dr. Fritz B. Simon es beschreibt – strukturell an den Markt gekoppelt sind. Diese Kopplung bedeutet: Organisationen sind autonom. Sie entscheiden selbst, wie sie handeln. Aber sie können nicht entscheiden, ob sie handeln, wenn sich der Markt bewegt. Der Markt kann die Organisation nicht steuern, aber er kann sie irritieren , bis sie sich selbst steuert, um Anschluss zu behalten. Oder einfacher gesagt: Der Markt ist wie das Wetter. Du kannst es nicht ändern, aber du kannst entscheiden, ob du mit Regenschirm rausgehst oder klatschnass wirst. Drei Beispiele, die jeder kennt Kodak war einst der König der Fotografie – bis man die Digitalisierung verschlief. Die Erkenntnis kam nicht aus dem Unternehmen heraus. Sie kam, als es zu spät war. Nokia dominierte den Mobilfunkmarkt – und scheiterte daran, die Relevanz des Smartphones zu erkennen. Nicht interne Prozesse brachten die Wende, sondern der Markt, der sich einfach in eine neue Richtung bewegte. RIM – Research in Motion – war der Vorreiter in Sachen Business-Phones, bis Apple das Thema mit dem IPhone auf ein völlig neues Niveau katapultierte. 2010 gab RIM das Geschäft auf. In nur einem Jahr verlor RIM die Marktdominanz an Apple. Der Markt ist kein Planungsinstrument, er ist ein existenzieller Realitätstest. Wenn man ihm zuhört! Veränderung beginnt nicht mit Einsicht, sondern mit Druck Natürlich gibt es auch interne Initiativen. Natürlich entstehen Innovationen auch im Kleinen. Aber die Regel bleibt: Solange es keinen äußeren Zwang gibt, bleibt die Organisation sich selbst treu. Denn intern bedeutet Veränderung: Verlernen. Unsicherheit. Neue Machtverhältnisse. Konflikte. Und warum sollte man sich das antun, wenn alles noch irgendwie funktioniert? Was heißt das für Führung? Wer Unternehmenskultur ernsthaft verändern will, muss begreifen: Man kann sie nicht anordnen – man kann nur an den Rahmenbedingungen arbeiten, die ihre Entstehung begünstigen. Und diese Rahmenbedingungen ändern sich dann, wenn sich der Markt verändert. Zwei Empfehlungen für Führungskräfte: Wie man die Kopplung zum Markt stärkt Wenn Organisationen sich nur unter echtem Umwelt-Druck verändern, dann liegt eine zentrale Führungsfrage auf der Hand: Wie können wir dafür sorgen, dass dieser Druck schneller, klarer und wirksamer bei uns ankommt – bevor es zu spät ist? 1. Den Markt regelmäßig in den Mittelpunkt rücken und nicht nur bei der Jahresplanung In vielen Unternehmen ist der Markt so präsent wie das Faxgerät – irgendwie da, aber selten wirklich in Gebrauch. Deshalb: Holt Kunden, Wettbewerbsbeobachtungen, Technologietrends nicht nur ins Marketing, sondern tiefer ins Unternehmen. Führt regelmäßig Formate ein, in denen Vertrieb, Service, Produktentwicklung oder Partner erzählen dürfen, was sie draußen hören – ohne PowerPoint, aber mit Gehör. Warum das hilft: Das erhöht die Irritationsfähigkeit der Organisation. Schwache Signale werden schneller wahrgenommen und können zu internen Bewegungen führen, bevor sie zur Krise werden. 2. Entscheidungskompetenz dorthin geben, wo die Irritation spürbar wird Dr. Gerhard Wohland beschreibt Organisationen als Systeme mit einem Zentrum und einer Peripherie. Während das Zentrum oft in Prozessen und Planung vertieft ist, steht die Peripherie an der Front – im Kontakt mit Kunden, Problemen, Echtzeitmarkt. Und genau da sollte mehr Entscheidungsspielraum hin: Empowerment ist kein nettes Buzzword – es ist strukturelle Notwendigkeit. Wer nur zentral entscheidet, entscheidet oft zu spät – und an der Realität vorbei. Warum das hilft: Nur wer die Irritation spürt, kann wirklich angemessen reagieren. Die Organisation bleibt handlungsfähig – nicht weil sie schneller denkt, sondern weil sie dort denkt, wo’s wehtut. Der Markt ist der eigentliche Veränderer, der Rest ist Reaktion Unternehmenskultur lässt sich nicht anordnen. Sie ist das Produkt dessen, was täglich gesagt, entschieden und getan wird. Und sie verändert sich nicht durch gute Absichten, sondern durch Irritation – durch spürbaren Druck, meist von außen. Nur der Markt bringt Organisationen wirklich in Bewegung. Nicht weil er befiehlt, sondern weil er die Spielregeln verändert. Und weil Organisationen, wenn sie überleben wollen, nicht anders können, als sich selbst zu verändern. Wer als Führungskraft heute handeln will, tut gut daran, nicht auf die nächste Krise zu warten, sondern aktiv die Kopplung zur Umwelt zu stärken: Hört den Markt – nicht nur einmal im Jahr, sondern kontinuierlich. Gebt denen Entscheidungsfreiheit, die den Markt als Erste spüren. Denn am Ende gilt: Der Markt klopft nicht höflich – er drückt. Die Frage ist nur: Öffnen wir rechtzeitig die Tür?

Entscheidungen sind überall und allgegenwärtig. In Organisation bilden Entscheidungen Kommunikationsmuster aus, die die Organisation als System stark prägen. Entscheidungen sind jedoch selten endgültige Lösungen, sondern vielmehr der Beginn neuer Herausforderungen . Jede Entscheidung reduziert zunächst die Komplexität einer Situation, indem sie eine bestimmte Handlungsalternative wählt und damit andere ausschließt. Doch genau diese gewählte Handlungsoption generiert oft neue, unvorhergesehene Probleme. Dieses Phänomen beschreibt die Systemtheorie als "Entscheidungen als Problemgeneratoren" . Ein weiteres zentrales Konzept ist die Kontingenz von Entscheidungen . Das heißt, dass Entscheidungen nie alternativlos sind – es hätte auch anders entschieden werden können. Doch sobald eine Wahl getroffen ist, schließen sich andere Optionen, und neue Abhängigkeiten entstehen. Die folgende sehr persönliche Geschichte aus meiner Vergangenheit als Pilot veranschaulicht beide Prinzipien auf, zugegeben, sehr individuelle Art und Weise: Eine spontane Entscheidung im Cockpit – scheinbar harmlos – führt zu einer gefährlichen Verkettung von Ereignissen. Schnelle wurde mir seinerzeit klar, dass es meine letzte Entscheidung gewesen sein könnte. Wie eine einzige Entscheidung eine Kette neuer Probleme generiert, welche Konsequenzen sie nach sich zieht und warum im Nachhinein oft klar wird, dass auch andere Optionen möglich gewesen wären – all das zeigt diese Geschichte eindrucksvoll. Ein Looping, ein Blackout und eine prägende Erkenntnis Der Sommer 1995 war einer der heißesten, die ich bis dahin erlebt hatte – selbst in England. Ich befand mich in Barkston Heath, einem kleinen Flugplatz etwa 30 Meilen östlich von Nottingham, mitten in meiner Pilotenausbildung. Gleichwohl ich Hubschrauber fliegen wollte, war dieser Teil meiner Pilotenausbildung auf einem Flächenflugzeug. An diesem Tag stand ein Solo-Übungsflug auf dem Plan, der mich auf meinen bevorstehenden Checkflug vorbereiten sollte. Last Chance Check, sozusagen. Mein Flugzeug: die Slingsby Firefly , ein kunstflugtaugliches Propellerflugzeug, war als robustes und leistungsfähiges Flugzeug bekannt – als kunstflugtaugliches Flugzeug konnte sie Beschleunigungsbelastungen von +6 g und -3 g ertragen . Falls das nach einer Zahl ohne Bedeutung klingt, hier eine kleine Erklärung: +6 g bedeutet, dass man plötzlich das Sechsfache seines Körpergewichts wiegt. Klingt beeindruckend – ist es auch, vor allem wenn man die Effekte dieser Beschleunigungen an eigene Körper erfahren darf. Denn wenn das Blut unter dieser Belastung aus dem Gehirn in die Füße gepresst wird, passiert etwas sehr Unangenehmes: Kein Blut im Gehirn = kein Denken, kein Sehen = G-Loc. Kein Denken, kein Sehen, kein Bewusstsein = Blackout. Was ein Blackout war, wusste ich natürlich. Theoretisch. Routine, Übermut und ein spontaner Geistesblitz Es lief soweit alles nach Plan. Ich flog in den zugewiesenen Ausbildungssektor westlich von Barkston Heath, um mein Solo-Kunstflugprogramm zu üben. Jeder Flugschüler musste ein eigenes Programm entwickeln, das über Wochen trainiert und schließlich bewertet wurde. Mein Checkflug stand an, also sollte heute alles sitzen. Ich begann mit den klassischen Manövern: Wingovers – elegante, weiche Richtungswechsel. Pedal-Turns – ein bisschen was fürs Gleichgewichtsorgan. Loopings – weil geradeaus fliegen einfach langweilig ist. Steep-Turns – um zu testen, wie lange das Frühstück im Magen bleibt. Nach etwa der Hälfte des Fluges war ich mit meinem Programm zufrieden. Alles lief wie geschmiert. Ich nahm mir eine kurze Pause und genoss den Moment. Und genau da kam mir eine Idee. „Ich habe noch nie einen Looping aus dem Rückenflug geflogen. Warum eigentlich nicht?“ Ein besonnener Mensch hätte diesen Gedanken vermutlich verworfen und sein Schicksal nicht herausgefordert. Ich nicht. Das Experiment ohne Vorbereitung Ohne weiter darüber nachzudenken, drehte ich das Flugzeug in den Rückenflug . Plötzlich hing ich kopfüber in den Gurten, während das Blut – der Schwerkraft folgend – in meinen Kopf rauschte. Falls du je wissen wolltest, wie sich das anfühlt: Es ist, als würde dein Gehirn gegen deine Stirninnenseite gedrückt werden. Nicht gerade angenehm, aber gut auszuhalten. Zeit für den Looping. Was ich in diesem Moment völlig vergaß: Es gibt einige grundlegende Regeln für so ein Manöver. Und ich brach sie alle . Vor einem Looping aus dem Rückenflug muss die Motorleistung reduziert werden , damit die Geschwindigkeit nicht unkontrolliert ansteigt. Ich ließ das Gas voll aufgedreht. Je höher die Geschwindigkeit im Manöver, desto höher die g-Kräfte. Durch den Sinkflug stieg die Geschwindigkeit zusätzlich rasant an, und ich wurde viel schneller als geplant. Bei hohen g-Kräften braucht es Anti-g-Maßnahmen , damit das Blut im Gehirn bleibt, und man nicht bewusstlos wird – Blackout. - Muskelanspannung in den Beinen um das Blut oben zu halten - Spezielle Atemtechnik mit kurzen, schnellen Atemzyklen Im Eifer des inneren Gefechts tat ich leider nichts davon. Dann zog ich am Steuerknüppel – und die g-Kräfte schlugen unbarmherzig zu. Blackout – und das System entscheidet selbst Die Ereignisse überschlugen sich innerhalb von Sekunden. Mein Körper wurde mit +6 g belastet. Das Blut wurde aus meinem Gehirn in meine Beine gedrückt. Mein Sehvermögen wurde grau (Gray-out). Dann verlor ich mein Gehör. Dann wurde alles schwarz. Mein letzter Gedanke war: "Das war’s." Was dann passierte, kann ich nicht wirklich erklären – denn ich war bewusstlos. Aber als ich wieder zu mir kam, hörte ich plötzlich Geräusche des Motors. Mein Gehör kehrte zurück, und vor meinen Augen erschien… blauer Himmel. Moment. Blauer Himmel? Dann begriff ich: Die Maschine zeigte senkrecht nach oben. Irgendwie hatte ich im Blackout den Steuerknüppel festgehalten und den Looping vollendet. Glücklicherweise war ich hoch genug. Das Flugzeug war in einem perfekten Steigflug – und just in diesem Moment kam ich wieder zu mir. Das Glück ist einstweilen mit den Dummen! Und dann traf ich die nächste Entscheidung und tat das einzig Richtige: Nichts. Ich ließ das Flugzeug tun, was es für richtig hielt: - Die Geschwindigkeit nahm ab. - Die Nase senkte sich. - Die Maschine richtete sich von selbst wieder in den Geradeaus-Flug aus. Mit zitternden Knien saß ich im Cockpit, und mir war hundeübel. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Antwort: nix. Aber; Ich war am Leben. Eine Lektion über Kontingenz und Problemgenerierung Als ich zurückflog, wurde mir bewusst: Ich hatte wirklich alles falsch gemacht. Ich war überheblich und dachte, ich könnte improvisieren Ich hatte das Risiko nicht richtig eingeschätzt Ich hatte die Konsequenzen nicht abgeschätzt Ich hatte gegen alles verstoßen, was ich in meiner Ausbildung gelernt hatte Kurz gesagt: Ich war ein Idiot mit Glücksbonus. Doch aus systemtheoretischer Sicht war meine Erfahrung hochinteressant. Damals hatte ich noch keine Ahnung von diesen Zusammenhängen. Entscheidungen als Problemgeneratoren Manchmal entstehen die spannendsten Erkenntnisse genau dann, wenn man sie am wenigsten erwartet – zum Beispiel kopfüber in einem Flugzeug, kurz bevor einem die g-Kräfte das Bewusstsein rauben, und kurz nachdem eine dumme Entscheidung getroffen hat. Meine Geschichte ist mehr als nur ein leichtsinniges Flugmanöver. Sie zeigt, warum Entscheidungen nicht nur Probleme lösen, sondern gleichzeitig neue erschaffen. Kontingenz in der Ausgangsentscheidung: Probieren oder lassen? Alles begann mit einer vermeintlich simplen Entscheidung: Soll ich diesen Looping aus dem Rückenflug ausprobieren oder nicht? Rein objektiv betrachtet gab es keinen Zwang. Niemand hatte mir gesagt: „Fliege diesen Looping du Wurst“ Aber genau das macht diese Entscheidung kontingent – sie hätte auch anders ausfallen können. Und das hätte sie auch müssen, so im Nachhinein. Doch stattdessen entschied ich mich für den „Lass es uns einfach mal versuchen“-Ansatz . Entscheidungen reduzieren Möglichkeiten. Sobald eine Entscheidung getroffen ist, erscheinen andere Wege, die vorher offenstanden, plötzlich ausgeschlossen. Entscheidungen reduzieren damit die Komplexität. Übertrag auf Organisationen: Entscheidungen in Unternehmen sind diesem Mechanismus ebenfalls unterworfen: - Investieren wir in eine neue Technologie oder optimieren wir unser bestehendes Geschäft? - Betreten wir einen neuen Markt oder konzentrieren wir uns auf bestehende Kunden? - Agieren wir offensiv oder defensiv? - Agil oder eben nicht? Jede Entscheidung bedeutet: Ein Weg wird gewählt, andere werden (scheinbar) ausgeschlossen. Doch was folgt danach? Kontingenz und Unsicherheit: Der Moment, in dem es zu spät war Kaum hatte ich den Looping eingeleitet, merkte ich: Das fühlt sich nicht gut an. Hätte ich hier abbrechen können? Theoretisch ja. Praktisch? Nun ja… Jede Entscheidung erschafft neue Probleme, die gelöst werden müssen. Glücklich ist der, der genug Flughöhe hat, um diese neuen Probleme zu lösen Entscheidungen erzeugen Folgeentscheidungen. Es gibt keinen „Punkt des perfekten Wissens“, an dem man genau weiß, was passieren wird. Entscheidungen müssen oft unter Unsicherheit getroffen werden – das gilt für Piloten genauso wie für Unternehmenslenker. Übertrag auf Organisationen: Entscheidungen in Organisationen lösen immer wieder neue Entscheidungsnotwendigkeiten aus: Ein Unternehmen investiert in eine neue Technologie – doch plötzlich treten ungeahnte Probleme auf. Eine Expansion wird beschlossen – aber dann ändern sich Marktbedingungen. Eine neue Strategie wird entwickelt – aber sie erfordert weitere Anpassungen an bestehende Prozesse. Die Systemtheorie nennt das „doppelte Kontingenz“: Nicht nur die Entscheidung selbst ist ungewiss, sondern auch ihre Folgen. Nicht alle Entscheidungen haben einen vorhersehbaren Ausgang. Manchmal treten Faktoren auf, die nicht planbar sind – oder das System reguliert sich selbst, aber nicht immer zu unseren Gunsten. Übertrag auf Organisationen: Unternehmen erleben oft, dass Entscheidungen nicht die erwarteten Folgen haben: Eine neue Marktstrategie kann durch plötzliche externe Ereignisse (z. B. Wirtschaftskrisen) hinfällig werden. Eine Reorganisation kann zu unerwarteten Widerständen führen. Ein „sicherer“ Geschäftszweig kann sich durch unvorhersehbare technische Entwicklungen als Sackgasse entpuppen. Nicht alles ist steuerbar. Entscheidungen setzen Prozesse in Gang, deren Konsequenzen sich erst später zeigen. Der Unterschied von kompliziert und komplex. Entscheidungen sind nie das Ende – sondern immer der Anfang neuer Probleme Mein spontaner Looping löste eine ganze Kette an Problemen aus, die ich vorher nicht bedacht hatte: Ich wollte nur meine Routine durchbrechen – und brachte mich fast um. Ich dachte, ich hätte die Kontrolle – bis mein Körper entschied, dass er aussteigt. Ich verließ mich darauf, dass alles gut geht – und wurde vom Zufall gerettet. Abschließendes: 1. Jede Entscheidung ist kontingent. Sie hätte auch anders ausfallen können – aber einmal getroffen, gibt es kein Zurück mehr. 2. Jede Entscheidung löst ein Problem – und erzeugt neue. Mein ursprüngliches „Problem“ war Langeweile. Das „löste“ ich mit einem waghalsigen Manöver – und schuf mir damit ein sehr viel größeres Problem. 3. Die Folgen von Entscheidungen sind selbst kontingent. Man kann nicht alles vorhersehen. Systeme reagieren oft überraschend – im Guten wie im Schlechten. Sie sind halt komplex. 4. Lernen geschieht erst nach der Entscheidung. Erst nach dem Manöver wusste ich, dass ich alles falsch gemacht hatte – aber nicht jeder Fehler ist überlebbar. Glück gehabt. Schlussgedanke: Keine Entscheidung ist auch eine. Nicht entscheiden funktioniert nur, wenn es nichts zu entscheiden gibt. PS: Und falls Sie je in Versuchung kommen, einen Looping aus dem Rückenflug zu fliegen: Erst nachdenken und dann entscheiden .

"Jedes Unternehmen bekommt die Kultur, die es verdient" Unternehmenskultur ist eines der meist diskutierten Themen in Organisationen. Und auch eines der undurchsichtigsten. Für die meisten ist Kultur alles. Sie soll Innovation fördern, Zusammenarbeit verbessern, Talente anziehen und für ein produktives, motivierendes Arbeitsumfeld sorgen. Doch so oft sie thematisiert wird, so wenig treffen die Diskussionen den wahren Kern der Mechanismen einer Kultur. Der häufigste Irrtum in der Diskussion um Unternehmenskultur ist die Annahme, dass sie sich gezielt gestalten oder verändern ließe – als wäre sie ein Produkt, das man entwickeln oder eine Maschine, die man umrüsten könnte. Da werden Change-Initiativen initiiert noch und nöcher und die nächste Kuh durchs Dorf getrieben, bis sie an Herzversagen stirbt und der Hirte wieder einmal enttäuscht zurück bleibt. Doch Organisationen sind keine Maschinen, so sehr sich die klassische Berater-Industrie und manches Management auch bemüht. Sie sind keine komplizierten Systeme mit vorhersehbaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, sondern hochdynamische soziale Systeme – also komplex. Das bedeutet, dass jede Intervention in eine Organisation nicht linear wirkt, sondern sich auf unvorhersehbare Weise entfaltet. Die Kultur eines Unternehmens ist daher kein direkt steuerbares Element , sondern das Ergebnis eines sich selbst verstärkenden Kommunikations- und Entscheidungssystems. Kultur nicht das, was sich ein Unternehmen wünscht oder das Management festlegt, sondern das, was sich durch wiederkehrende Kommunikation, Entscheidungsmechanismen und Strukturen immer wieder selbst erzeugt. Ein Unternehmen „verdient“ sich also genau die Kultur, die es durch sein eigenes Verhalten erschafft – nicht durch seine Absichten, sondern durch seine tägliche Praxis. Um Kultur in Unternehmen verstehen zu können, braucht es ein besonderes Werkzeug. Dieses Werkzeug ist die Systemtheorie. Doch was bedeutet das konkret? Schauen wir uns die vier systemtheoretischen Grundsätze zur Kultur in Organisationen an. 1. Kultur entsteht durch wiederkehrende Kommunikation – nicht durch Absicht Unternehmenskultur ist kein bewusst gestaltetes Artefakt, sondern ein emergentes Phänomen. Sie entwickelt sich aus den Kommunikationsmustern und Entscheidungsprozessen, die sich in einer Organisation über die Zeit etabliert haben. Sie ist das „Gedächtnis“ der Organisation, gespeist aus der täglichen Interaktion ihrer Mitglieder. Ein zentrales Missverständnis ist die Annahme, dass Kultur sich durch strategische Entscheidungen oder ein klares Managementziel gezielt verändern ließe. Doch Organisationen folgen keiner linearen Kausalität. Man kann nicht einfach einen Hebel umlegen und erwarten, dass die Kultur sich anpasst. Das bedeutet: - Kultur ist nicht das, was ein Unternehmen in Leitbildern formuliert, sondern das, was sich im täglichen Kommunikations- und Entscheidungsverhalten manifestiert. - Organisationen „verdienen“ ihre Kultur, weil sie durch ihre eigenen Mechanismen genau diese Kultur kontinuierlich reproduzieren. Beispiele aus der Praxis: Ein Unternehmen, das Entscheidungen durch langwierige Gremienprozesse schleust, entwickelt zwangsläufig eine Kultur der Absicherung und Entscheidungsverzögerung . Ein Unternehmen, das schnelle, kreative Problemlösung zulässt, entwickelt eine Kultur der Eigenverantwortung und Innovation . Ein Unternehmen in dem das Management eine Vertrauenskultur ausruft und propagiert, nur um dann durch Kontrollmechanismen jegliches Entstehen von Vertrauen erstickt. Kultur ist kein Planungsziel, sondern das, was Organisationen durch ihre täglichen Strukturen und Routinen immer wieder selbst erschaffen. 2. Kultur reduziert Unsicherheit – und wird dadurch stabil Organisationen bewegen sich in einem Umfeld voller Unsicherheiten → Markt = relevante Umwelt. Die Anzahl möglicher Handlungsoptionen ist unendlich, und um in diesem Chaos handlungsfähig zu bleiben, braucht es gemeinsame Orientierungspunkte. Kultur ist eines dieser Orientierungsangebote. Sie reduziert Komplexität, indem sie Erwartungen stabilisiert, Routinen etabliert und soziale Normen schafft. Doch genau diese stabilisierende Wirkung macht sie auch träge. Je länger ein bestimmtes Muster existiert, desto mehr verstärkt es sich selbst. Das bedeutet: - Unternehmen „verdienen“ ihre Kultur, weil sie sich im Laufe der Zeit auf bestimmte Sinnangebote (z. B. „Wir sind innovativ“ oder „Hierarchien sind wichtig“) festlegen, um stabil zu bleiben. - Ist eine Kultur erst einmal etabliert, verstärkt sie sich selbst – weil immer wieder nach denselben Mustern kommuniziert und entschieden wird. Beispiele aus der Praxis: Wird in einem Unternehmen regelmäßig betont, dass Fehler vermieden werden müssen , entsteht eine Kultur der Risikoaversion und Bürokratie . Wird dagegen aktiv kommuniziert, dass Fehler Lernchancen sind , entwickelt sich eine Kultur der Experimentierfreude und Agilität . Wenn sie abends Ihr Unternehmen verlassen, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass Sie am nächsten Morgen Erwartungssicherheit darüber haben, was Sie erwartet. Kultur ist ein sich selbst stabilisierendes System – keine variable Größe, die nach Belieben verändert werden kann. 3. Kultur kann nicht direkt gesteuert werden – nur beobachtet und beeinflusst In komplizierten Systemen lassen sich Veränderungen direkt steuern: Dreht man an einer Schraube, ändert sich das Ergebnis vorhersehbar. In einer Maschine kann man Prozesse optimieren und genau messen, wie sich eine Veränderung auswirkt. Doch Organisationen sind komplexe Systeme . Das bedeutet: Sie entziehen sich direkter Steuerung. Kultur ist kein Produkt, das sich per Dekret verändern lässt. Sie entsteht aus Millionen alltäglicher Kommunikationsakte und lässt sich daher nicht einfach „umbauen“. Das bedeutet: - Unternehmen „verdienen“ ihre Kultur nicht durch Absicht, sondern durch ihre tägliche Praxis der Kommunikation, Führung und Entscheidungslogik. - Kultur lässt sich nicht durch einen „Kulturwandel“-Workshop ändern, sondern nur durch nachhaltige Veränderungen in der Art und Weise, wie kommuniziert und entschieden wird. Beispiele aus der Praxis: Ein Unternehmen predigt „flache Hierarchien“, aber faktisch müssen alle Entscheidungen über mehrere Eskalationsstufen abgesichert werden. Die Organisation bleibt hierarchisch – verdientermaßen. Ein Unternehmen wirbt mit „offener Kommunikation“, gibt aber nur selektiv Informationen weiter. Es entwickelt zwangsläufig eine Misstrauenskultur . Kultur entsteht nicht durch Absichtserklärungen, sondern durch wiederkehrende Muster des täglichen Handelns. 4. Kultur ist träge – und schwer veränderbar Kultur ist nicht einfach ein Set von Regeln, das man umschreiben kann. Sie ist tief in den Strukturen einer Organisation verankert und wird durch jeden Kommunikationsakt stabilisiert. Daher widersteht sie Veränderung – selbst wenn ein Unternehmen aktiv versucht, sie zu verändern. Das bedeutet: - Je länger eine bestimmte Kultur existiert, desto resistenter wird sie gegenüber Veränderung. - Selbst wenn das Management eine neue Kultur will, bleiben alte Muster oft bestehen – weil Organisationen dazu neigen, sich selbst zu erhalten. Beispiel: Ein Unternehmen will von einer kontrollierten Fehlervermeidungskultur zu einer agilen Innovationskultur wechseln. Doch wenn weiterhin Sanktionen für Fehler existieren und Entscheidungen. Was bedeutet das für den Führungsalltag? ✔ Beobachten, statt verordnen: Statt Kultur „zu ändern“, sollten Führungskräfte erst einmal verstehen, wie sie entstanden ist . ✔ Kommunikation gestalten: Die tägliche Art und Weise, wie kommuniziert wird, formt die Kultur viel stärker als jede Strategie. ✔ Verhaltensweisen vorleben: Wer eine Kultur etablieren will, muss sie leben. ✔ Entscheidungsmechanismen hinterfragen: Schnelligkeit und Agilität entstehen nicht durch Slogans, sondern durch Strukturen, die sie ermöglichen. Kultur ist das, was eine Organisation tut – nicht das, was sie sich wünscht. Wer eine neue Kultur will, muss die zugrunde liegenden Muster der Organisation verändern – nicht die oberflächlichen Symptome.

In der Luftfahrt gibt es zahlreiche Herausforderungen, die ein Pilot meistern muss. Eine der gefährlichsten ist die räumliche Desorientierung, also die Unfähigkeit, die eigene Position im Raum korrekt wahrzunehmen. Eine besonders tückische Form dieser Desorientierung ist das Phänomen „The Leans“ – eine Sinnestäuschung, die dazu führt, dass sich das Flugzeug in einer vermeintlichen Schräglage befindet, obwohl es in Wirklichkeit gerade fliegt. Dieses Phänomen und dessen Effekte auf mein inneres Vertrauen als auch das Vertrauen in andere, die mit mir im Cockpit saßen, habe ich oft selbst erleben „dürfen“. Als Fluglehrer war es eine Aufgabe, Flugschüler gezielt in die räumliche Desorientierung zu fliegen, damit sie die Effekte auf ihre Wahrnehmung kennenlernen konnten. Alles hatte zum Ziel, den Umgang mit der Unsicherheit zu trainieren. Bei „The Leans“ handelt es sich um die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Realität und der inneren Wahrnehmung der Realität. Solche Illusionen sind nicht nur in der Luftfahrt, im Cockpit gefährlich, sondern auch in anderen komplexen Systemen, in denen Menschen Entscheidungen unter Unsicherheit treffen müssen – etwa in der Unternehmensführung. Teams und Führungskräfte können ebenfalls einem verzerrten Realitätsempfinden unterliegen und auf der Basis dieser falscher Annahmen handeln. Besonders wenn es um Kontrolle und Vertrauen geht, können Führungskräfte unter einer Art „The Leans“ leiden: einem tiefsitzenden Misstrauen genährt durch die innere Wahrnehmung und dem Glauben, das die eigene Realität absolut ist. Dieses kann zu übermäßiger Kontrolle verleitet, selbst wenn diese nicht gerechtfertigt oder gar schädlich ist. Die eigene Wahrnehmung ist für Menschen immer die Wirklichkeit. Sie ist absolut. Von diesem Prinzip abzuweichen, benötigt eine tiefere Auseinandersetzung mit dem eigenen Sein, der Grenzen eigener Wahrnehmung und der Erkenntnis, dass die eigene Realität nur eines ist, individuell. Die Parallelen zwischen der Luftfahrt und der Organisationsführung sind überraschend deutlich – und liefern wertvolle Einsichten darüber, wie Vertrauen eine Schlüsselrolle für effektive Führung spielt. Eine Illusion mit fatalen Folgen „The Leans“ tritt auf, wenn ein Flugzeug unbemerkt in eine leichte Schräglage gerät, die über einen längeren Zeitraum beibehalten wird. Das Gleichgewichtsorgan im Innenohr passt sich an diese neue Lage an, sodass sie vom Piloten als „normal“ wahrgenommen wird. Wird das Flugzeug anschließend wieder in eine gerade Fluglage gebracht, entsteht paradoxerweise das Gefühl, dass es nun in die entgegengesetzte Richtung kippt. Der Pilot steht nun vor einer kritischen Entscheidung: Vertraut er seiner eigenen Wahrnehmung und korrigiert die (vermeintliche) Schräglage? Oder verlässt er sich auf seine Instrumente, die ihm objektiv anzeigen, dass das Flugzeug tatsächlich geradeaus fliegt? Diese Täuschung kann erhebliche Konsequenzen haben. Verlässt sich der Pilot auf sein Gefühl seine eigene Wahrnehmung, steuert er möglicherweise unbewusst eine gefährliche Fluglage an. In schweren Fällen kann dies zu einem unkontrollierten Flugzustand führen, insbesondere bei schlechten Sichtverhältnissen oder Nachtflügen, wenn keine externen visuellen Referenzen vorhanden sind, ist das Phänomen „The Leans“ sehr verbreitet, da keine Rückkopplungschleife zwischen dem Gleichgewichtssinn und den visuellen Eindrücken besteht. Daher lautet eine der fundamentalsten Regeln in der Luftfahrt: „Vertraue den Instrumenten, nicht deinen Sinnen.“ Dieses Prinzip ist nicht nur für Piloten entscheidend, sondern auch kann für Führungskräfte in Unternehmen nützlich sein. Vertrauen und Kontrolle in der Unternehmensführung – Eine vergleichbare Herausforderung In der Unternehmensführung kann eine ähnlich trügerische Wahrnehmung entstehen. Führungskräfte, die sich in einem unsicheren Umfeld bewegen – sei es aufgrund von Marktvolatilität, internen Herausforderungen, mangelnden Selbstvertrauen oder mangelndem Zutrauen und Vertrauen in ihre Mitarbeitenden – können sich in einem Zustand chronischer Unsicherheit wiederfinden. Das Ergebnis ist oft eine übermäßige Kontrolle: Mikromanagement, weil die Führungskraft das Gefühl hat, dass ohne ihre ständige Intervention Fehler passieren. Detaillierte Berichtspflichten, weil sie den Status jedes Projekts lückenlos überwachen möchte. Übermäßige Entscheidungszentralisierung, weil sie glaubt, dass Delegation zu Fehlern führen könnte. Genau wie beim Phänomen „The Leans“ handelt es sich dabei um eine Fehlwahrnehmung der Realität : Die Führungskraft glaubt, dass ohne ihre Kontrolle das Unternehmen in eine „Schräglage“ gerät, obwohl es tatsächlich stabil läuft. Sie reagiert mit noch mehr Kontrolle, um die (nicht existierende) Schräglage zu korrigieren – und erzeugt damit erst die eigentlichen Probleme, die sie verhindern wollte. Führungskräfte, die in diesen Kontrollzwang verfallen, handeln oft nicht rational, sondern emotional – genau wie ein Pilot, der „The Leans“ erlebt. Die negativen Auswirkungen von übermäßiger Kontrolle Der Kontrollzwang in Organisationen hat weitreichende negative Konsequenzen, ähnlich wie die Fehlsteuerung eines Flugzeugs unter räumlicher Desorientierung. a) Vertrauensverlust und Demotivation Wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, dass ihre Arbeit ständig hinterfragt oder kontrolliert wird, sinkt ihr Engagement. Studien zeigen, dass übermäßige Kontrolle nicht nur demotiviert, sondern auch die Eigeninitiative und Kreativität hemmt. Menschen neigen dazu, sich in einem solchen Umfeld nur noch an Regeln zu halten, anstatt eigene Ideen einzubringen oder Verantwortung zu übernehmen. b) Verlangsamung von Prozessen und Entscheidungsfindung Eine Kultur des Misstrauens führt oft zu übermäßiger Bürokratie: Jede Entscheidung muss mehrfach überprüft, dokumentiert und genehmigt werden. Dies verlangsamt nicht nur operative Prozesse, sondern verhindert auch eine agile Anpassung an Marktveränderungen. c) Innovationshemmung In einem Umfeld, in dem Fehler nicht toleriert werden und Kontrolle allgegenwärtig ist, fehlt der Mut, neue Wege zu gehen. Unternehmen, die auf Innovation angewiesen sind, riskieren so, dass Mitarbeitende sich nicht trauen, Risiken einzugehen – aus Angst vor negativen Konsequenzen. Und was können wir Führungskräfte von Piloten lernen? Die Parallele zwischen „The Leans“ in der Luftfahrt und Kontrollzwang in Unternehmen zeigt deutlich: Fehlwahrnehmungen können dazu führen, dass Menschen Entscheidungen treffen, die ihre Situation verschlechtern, anstatt sie zu verbessern. Lösungsansätze für einen besseren Umgang mit „The Leans“ Den eigenen Wahrnehmungen nicht blind vertrauen Führungskräfte sollten sich bewusst machen, dass ihr subjektives Gefühl nicht immer mit der Realität übereinstimmt. Statt impulsiv auf Unsicherheiten zu reagieren, sollten sie sich auf objektive Daten, Feedback und das bewährte Prinzip von Fragen und Zuhören um zu vertsehen stützen. Gezielte Kontrolle statt Mikromanagement Kontrolle ist nicht grundsätzlich schlecht – aber sie sollte bewusst eingesetzt werden. Statt alles und jeden zu überwachen, sollten Führungskräfte klare Strukturen und Verantwortlichkeiten definieren, sodass Kontrolle nur dort nötig ist, wo sie tatsächlich Mehrwert schafft. Vertrauen als strategisches Instrument nutzen Vertrauen ist kein naiver „weicher Faktor“, sondern ein essenzielles Element als wirksamer Mechanismus in Organisationen und Management. Unternehmen, die die Emergenz von Vertrauen strukturell etablieren, profitieren von höherer Performance, gesteigerten Motivation, schnelleren Entscheidungen und einer gesteigerten Innovationsfähigkeit der Organisation. Eigenverantwortung fördern Indem Abgabe von Verantwortung nicht durch triviale Appelle eingefordert, sondern strukturell in der Organisation verankert ist, stärken sie die Eigenständigkeit der Teams und Mitarbeitenden. Dies reduziert nicht nur den Kontrollaufwand, sondern sorgt auch für eine resilientere und anpassungsfähigere Organisation. Fazit Das Phänomen „The Leans“ zeigt, dass subjektive Wahrnehmung und objektive Realität nicht immer übereinstimmen – mit potenziell gravierenden Konsequenzen. In der Luftfahrt kann dies zu tödlichen Fehlentscheidungen führen, in der Unternehmensführung zu ineffizienten, demotivierenden und innovationshemmenden Strukturen. Sowohl Piloten als auch Führungskräfte stehen daher vor der gleichen Herausforderung: Sie müssen lernen, wann sie Kontrolle loslassen und wann sie sich auf objektive Indikatoren verlassen sollten. Wer alles kontrollieren will, verliert am Ende oft genau das – die Kontrolle. Wer hingegen Vertrauen gezielt einsetzt, schafft nicht nur Stabilität, sondern auch Raum für Wachstum und Innovation.

Im Alltag von Führung und Organisationen schleichen sich gerne vage und ungenaue Definitionen und Verständnisse ein. So ist manches gerne kompliziert, während anderes doch eher komplex ist. Führung ist gleich Management, und mancher salzt alles noch mit ein wenig Steuerung. Um nur zwei alltägliche Beispiele zu nennen. Es hat sich eine Tendenz der Sprachunreinheit und Verallgemeinerung eingebürgert – gegebenenfalls auch, weil niemand sich wirklich mit den Begriffen und deren tieferer Bedeutung auseinandersetzt bzw. auseinandersetzen will. Und in der Zeit von Massenschlagzeilen, bei denen nur der Grad der Aufregung zählt, braucht es ein tiefergehendes Verständnis. Ein Phänomen, dem ich immer wieder begegne, ist die allgemeine Verwendung des Wortes Vertrauen – vor allem im Kontext von Teams, Organisationen und Führung. Vertrauen ist alles oder gegebenenfalls auch nichts, da es so verschwenderisch verwendet wird, dass es eigentlich keine Bedeutung und Wirkung mehr entfalten kann. Ich bin der Überzeugung, dass die Arbeit mit Unterscheidungen und das Verständnis für sie einen elementaren Vorteil in der Arbeit mit Teams und Organisationen bringt. Daher möchte ich einen kleinen Exkurs in die Differenzierung von Zutrauen und Vertrauen als Reflexionsübung anbieten. Die Unterscheidung zwischen Zutrauen und Vertrauen ist ein zentrales Konzept in der Organisationsforschung und Teamdynamik. Beide Begriffe werden oft synonym verwendet, doch sie beschreiben unterschiedliche Facetten zwischenmenschlicher Beziehungen, die für den Erfolg von Teams und Organisationen entscheidend sind. Doch was ist der Unterschied? Während Zutrauen auf der Einschätzung von Kompetenzen basiert, geht Vertrauen tiefer und umfasst die emotionale Sicherheit und das gegenseitige Wohlwollen innerhalb eines Teams. Anders gesagt: Bei Zutrauen setze ich meinen Glauben in die andere Person auf deren faktische Fähigkeiten, ihr Wissen und Talent. Ist derjenige qualifiziert, die Aufgabe zu erledigen? Es basiert auf Wissen. Bei Vertrauen gehe ich eine Wette ein. Ich akzeptiere Unsicherheit, indem ich eine emotionale Wette auf die Integrität und die wohlwollenden Absichten des anderen eingehe. Es basiert auf einem Gefühl. 1. Die Differenzierung zwischen Zutrauen und Vertrauen Zutrauen ist die kognitive Einschätzung der Fähigkeiten, des Wissens und der Kompetenzen einer Person. Es bedeutet, dass ich anderen zutraue, eine Aufgabe erfolgreich zu erledigen, weil ich an ihre Fachkompetenz glaube. Dieser Aspekt ist besonders in hochspezialisierten Teams wichtig, in denen technische Fähigkeiten und Erfahrungen entscheidend für den Erfolg sind. Vertrauen hingegen ist eine emotionale Wette auf die Zukunft . Es bezieht sich nicht nur auf die Fähigkeit einer Person, sondern auch auf ihre Absicht und Integrität . Vertrauen bedeutet, dass ich glaube, die andere Person wird ihr Wissen und ihre Fähigkeiten nicht gegen mich oder das Team einsetzen, selbst wenn sie die Möglichkeit dazu hätte. Diese Differenzierung ist entscheidend, weil sie erklärt, warum Teams trotz hoher Fachkompetenz scheitern können: Es fehlt nicht am Zutrauen in die Fähigkeiten, sondern am Vertrauen in die Absichten der Teammitglieder. Und umgekehrt sind Teams nicht handlungsfähig, wenn sie ein hohes Maß an Vertrauen haben, es aber am Zutrauen in die gegenseitigen Fähigkeiten mangelt. 2. Die Bedeutung von Zutrauen und Vertrauen in Teams In Teams spielt die Balance zwischen Zutrauen und Vertrauen eine zentrale Rolle. Studien zeigen, dass Teams, die sowohl fachlich kompetent sind als auch ein hohes Maß an Vertrauen untereinander haben, nicht nur leistungsfähiger , sondern auch resilienter und innovativer sind. Zutrauen stärkt die Arbeitsdynamik: Wenn Teammitglieder sich gegenseitig ihre Fähigkeiten und Kompetenzen anerkennen, führt das zu effizienter Aufgabendelegation und einem reibungslosen Arbeitsfluss . Dies ist die Grundlage für eine funktionierende operative Zusammenarbeit. Vertrauen stärkt die emotionale Bindung: Vertrauen sorgt dafür, dass Teams nicht nur als Arbeitsgemeinschaften, sondern als echte Gemeinschaften funktionieren. Vertrauen ermöglicht offene Kommunikation , das Eingestehen von Fehlern und das Ansprechen von Unsicherheiten ohne Angst vor negativen Konsequenzen. Eine Untersuchung von Google's Project Aristotle (2015) zeigt, dass psychologische Sicherheit – ein Konzept, das eng mit Vertrauen verbunden ist – der wichtigste Faktor für die Effektivität von Teams ist. Psychologische Sicherheit entsteht, wenn Teammitglieder darauf vertrauen, dass sie ohne Angst vor negativen Konsequenzen Risiken eingehen, Fragen stellen und Fehler zugeben können. Wir haben die Zutaten, die es braucht, um die Entstehung von Vertrauen in Teams und Organisationen wahrscheinlicher zu machen, in vorherigen Artikeln bereits beleuchtet. Vielleicht ist es aber sinnvoll, einen kleinen Schritt zurückzumachen, um den Kontext klarer darzulegen. Hier geht es zu den vorhergehenden Artikeln: www.auftriebsberatung.de/blog Zutrauen entsteht, wenn jeder im Team seine Fähigkeiten einbringt, und lässt sich recht leicht anhand von Zertifikaten, Lizenzen und anderen Nachweisen von Qualifikation belegen. Vertrauen ist weit schwieriger aufzubauen. 3. Vertrauen durch Handlungen und Entscheidungen Vertrauen entsteht nicht durch Appelle oder wohlklingende Worte und auch nicht durch Zertifikate , sondern durch konkrete Handlungen und Entscheidungen . Studien von Dirks & Ferrin (2002) zeigen, dass Vertrauen in Führungskräfte vor allem durch konsistentes Verhalten , Transparenz und Verbindlichkeit aufgebaut wird. Transparenz und Verbindlichkeit: Vertrauen erfordert, dass Führungskräfte und Teammitglieder konsequent handeln und ihre Entscheidungen nachvollziehbar gestalten. Verbindlichkeit zeigt sich darin, dass Zusagen eingehalten werden und Erwartungen klar kommuniziert werden. Mut und Unsicherheit: Vertrauen ist immer mit einem Risiko verbunden, da es eine Vorschussleistung ist. Es bedeutet, sich in gewissem Maße verletzlich zu machen. Diese Bereitschaft, Unsicherheiten auszuhalten, ist ein Zeichen von Stärke – sowohl bei der Führung als auch bei den Teammitgliedern. Vertrauen entsteht nicht trotz der Anwesenheit von Risiko , sondern durch die Anwesenheit von Risiko. Ohne Risiko kein Vertrauen. Ein Beispiel aus meiner Zeit in der Luftfahrt verdeutlicht dies: Ich musste nicht nur darauf vertrauen, dass meine Kollegen technisch kompetent sind (Zutrauen), sondern auch darauf, dass sie in kritischen Situationen im Sinne des Teams handeln (Vertrauen) – in letzter Konsequenz, um alle am Leben zu halten. 4. Die Rolle von Zutrauen und Vertrauen in der Führung Die Unterscheidung zwischen Zutrauen und Vertrauen hat direkte Implikationen für Führungskräfte : Zutrauen in die Kompetenz der Mitarbeitenden: Führungskräfte müssen die Fachkompetenz ihrer Mitarbeitenden einschätzen und ihnen Aufgaben zutrauen, die ihren Fähigkeiten entsprechen. Ohne dies ist die Organisation nicht handlungsfähig und die Wertschöpfung kommt sehr wahrscheinlich zum Erliegen. Vertrauen in die Integrität der Mitarbeitenden: Über die fachliche Ebene hinaus müssen Führungskräfte ihren Mitarbeitenden vertrauen, dass sie im Sinne des Teams und der Organisation handeln. Dies ist fundamental, um eigenständige Entscheidungen treffen zu können, und fundamental für die Entscheidungsfähigkeit der Organisation. Eine Studie von Korsgaard et al. (2015) zeigt, dass Führungskräfte, die sowohl Zutrauen in die Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden zeigen als auch Vertrauen in deren Integrität haben, bessere Teamleistungen und eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit erreichen. Damit erhöht sich die Wertschöpfung der Organisation. Praktische Implikationen für Teams Lernkultur: Teams, in denen Vertrauen herrscht, entwickeln eine offene Lernkultur . Fehler und Irrtümer werden als Lernmöglichkeiten angesehen und nicht als Gründe für Schuldzuweisungen. Dies fördert eine innovative und resiliente Arbeitsumgebung. Selbstorganisation: In Teams, in denen ein hohes Maß an Autonomie herrscht, ist die Balance zwischen Zutrauen und Vertrauen besonders wichtig. Zutrauen sorgt dafür, dass Aufgaben effektiv verteilt werden, während Vertrauen sicherstellt, dass die Mitglieder auch in unsicheren Situationen Verantwortung übernehmen. Abschließend lässt sich sagen Die Unterscheidung zwischen Zutrauen und Vertrauen ist eine lohnenswerte Betrachtung, die Teams zu einem höheren Leistungsniveau verhelfen und Führungskräfte entlasten kann. Sie erlaubt ein besseres Verständnis von Teamdynamiken und Führungsvermögen innerhalb der Organisation. Darüber hinaus ermöglicht die Unterscheidung eine differenzierte Analyse von Mustern innerhalb der Teams und der Organisation, was bei Veränderungsinitiativen sehr hilfreich ist.

Die drei Gesichter von Organisationen: Warum Formalität, Informalität und Fassade unser Arbeiten prägen Wenn wir an Organisationen denken, kommen uns oft zuerst die klassischen Dinge in den Kopf: Organigramme, Jobtitel, Prozesse, Regeln – eben all das, was sichtbar und messbar ist. Doch wer in einer Organisation arbeitet, weiß: Das ist nur die halbe Wahrheit. Hinter den offiziellen Strukturen verbirgt sich eine Welt von inoffiziellen Netzwerken, persönlichen Beziehungen und unausgesprochenen Regeln. Und dann gibt es da noch das Bild, das die Organisation nach außen hin zeigt – das Leitbild auf der Website, die Hochglanzbroschüre oder der große Wert auf „Innovation“ und „Offenheit“, der sich in der täglichen Arbeit aber nicht immer widerspiegelt. Um zu verstehen, wie Organisationen wirklich "ticken", lohnt es sich, diese drei Seiten genauer anzuschauen: die formale Seite , die informale Seite und die Schauseite . Sie beeinflussen nicht nur, wie Entscheidungen getroffen werden, sondern auch, wie sich Mitarbeitende fühlen, wie gut Teams zusammenarbeiten – und ob eine Organisation langfristig erfolgreich ist. 1. Die formale Seite: Das sichtbare Gerüst der Organisation Die formale Seite ist das, was wir in Stellenbeschreibungen, Handbüchern oder Prozessdiagrammen finden. Sie umfasst alle offiziellen Regeln, Strukturen und Abläufe, die dafür sorgen sollen, dass der Laden läuft. Wer berichtet an wen? Welche Verantwortlichkeiten hat wer? Welche Prozesse müssen eingehalten werden? Formale Strukturen regeln: Hierarchien und Rollen: Wer darf was entscheiden? Wer ist für welche Aufgaben verantwortlich? Prozesse und Vorschriften: Wie laufen Projekte ab? Welche Abläufe sind festgelegt? Regeln und Programme: Welche Standards und Richtlinien müssen eingehalten werden? Diese Strukturen geben Orientierung und schaffen Verlässlichkeit. Sie helfen uns zu wissen, woran wir sind, und machen Organisationen effizient. Aber – und das kennen viele von uns aus eigener Erfahrung – zu viel Formalität kann auch lähmen. Wenn jeder Schritt durch ein Regelwerk bestimmt wird und kein Raum für eigene Entscheidungen bleibt, fühlen sich Mitarbeitende schnell eingeengt. Innovation und Flexibilität bleiben dann oft auf der Strecke. 2. Die informale Seite: Das unsichtbare Netzwerk hinter den Kulissen Doch Organisationen bestehen nicht nur aus Regeln und Strukturen. Hinter der formalen Fassade gibt es die informale Seite – die Netzwerke, Beziehungen und unausgesprochenen Regeln, die den Alltag prägen. Das sind die Gespräche in der Kaffeeküche, die Absprachen zwischen Kollegen, die nicht im Protokoll stehen, und die Machtverhältnisse, die nicht im Organigramm auftauchen. Zur informalen Seite gehören: Persönliche Netzwerke: Wer kennt wen? Wer hat Einfluss, auch wenn es nicht auf dem Papier steht? Ungeschriebene Regeln: Wie läuft der Hase hier wirklich? Was wird offen gesagt, und was lieber verschwiegen? Kulturelle Dynamiken: Vertrauen, Sympathien, aber auch Rivalitäten und Konflikte, die das Miteinander beeinflussen. Die informale Seite ist oft der Ort, an dem die eigentliche Arbeit passiert. Hier entstehen kreative Ideen, Probleme werden pragmatisch gelöst, und Informationen fließen abseits der offiziellen Wege. Aber: Informale Strukturen können auch problematisch sein. Wenn die richtigen Netzwerke wichtiger sind als Kompetenz, kann das zu Frustration führen. Und wenn informelle Machtstrukturen die offiziellen Entscheidungen unterlaufen, leidet die Glaubwürdigkeit der Führung. 3. Die Schauseite: Das Gesicht der Organisation nach außen Neben der formalen und informalen Seite gibt es noch die Schauseite – das Bild, das eine Organisation nach außen zeigt. Das ist das Leitbild auf der Website, die Hochglanzbroschüre, die Werbekampagne, die die Firma als besonders innovativ oder nachhaltig präsentiert. Aber auch nach innen wird eine Schauseite aufgebaut: Die Kultur, die offiziell kommuniziert wird, die Werte, die in Mitarbeiterhandbüchern stehen oder bei Townhall-Meetings betont werden. Typisch für die Schauseite sind: Corporate Identity und Leitbilder: Die offiziell kommunizierten Werte und Prinzipien – „Wir sind innovativ“, „Unsere Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt“, „Wir handeln nachhaltig“. Image und Außendarstellung: Wie präsentiert sich das Unternehmen gegenüber Kunden, Partnern oder Investoren? Symbolische Handlungen: Charity-Events, Preise, interne Veranstaltungen, die ein bestimmtes Bild vermitteln sollen. Die Schauseite ist wichtig, weil sie Vertrauen schafft – bei Kunden, Investoren und auch bei den Mitarbeitenden. Sie hilft, eine gemeinsame Identität zu stiften. Aber sie wird dann zum Problem, wenn sie nicht mit der Realität übereinstimmt. Wenn im Leitbild von „offener Kommunikation“ gesprochen wird, aber Mitarbeitende wissen, dass Kritik nicht erwünscht ist, entsteht Zynismus. Und wenn ein Unternehmen sich als nachhaltig inszeniert, aber intern anders handelt, verliert es nicht nur an Glaubwürdigkeit, sondern riskiert auch das Vertrauen der Öffentlichkeit. Das Zusammenspiel der drei Seiten: Die Kunst der Balance Keine Organisation funktioniert, wenn sie sich nur auf eine dieser Seiten konzentriert. Die formale Seite gibt Struktur, die informale Seite bringt Flexibilität, und die Schauseite sorgt für Identität und Außenwirkung. Das Problem entsteht, wenn diese drei Seiten auseinanderdriften . Formale und informale Seite müssen zusammenpassen: Die besten Prozesse und Regeln bringen nichts, wenn sie nicht von den informellen Netzwerken unterstützt werden. Umgekehrt kann eine starke informale Kultur ohne klare formale Strukturen ins Chaos führen. Die Schauseite muss authentisch sein: Leitbilder und Werte sollten nicht nur auf dem Papier existieren, sondern tatsächlich im Alltag gelebt werden. Wenn das, was die Organisation nach außen zeigt, nicht mit der internen Realität übereinstimmt, führt das zu Misstrauen – sowohl intern als auch extern. Vertrauen entsteht durch Kohärenz: Mitarbeitende vertrauen einer Organisation, wenn sie sehen, dass das, was gesagt wird, auch tatsächlich gelebt wird. Kunden und Partner vertrauen Unternehmen, die nicht nur Versprechungen machen, sondern diese auch einhalten. Organisationen sind mehr als die Summe ihrer Regeln Organisationen sind komplexe Systeme, die aus mehr bestehen als nur aus Regeln, Prozessen und Hierarchien. Die formale Seite sorgt für Struktur und Stabilität, die informale Seite bringt Flexibilität und Innovation, und die Schauseite schafft Identität und Vertrauen. Der Schlüssel liegt in der Balance . Wenn diese drei Seiten im Einklang sind, entstehen Organisationen, die nicht nur effizient arbeiten, sondern auch authentisch, flexibel und vertrauenswürdig sind. Wenn sie auseinanderdriften, drohen Ineffizienz, Misstrauen und Identitätsprobleme.
Vertrauen ist das Fundament jeder erfolgreichen Zusammenarbeit – und doch fällt es uns oft schwer, es wirklich zu leben. Ich habe in vorherigen Beiträgen in der Serie zu Vertrauen in Teams und Organisation viel über die Wirkmechansimen von Vertrauen gesprochen und meine eigenen Erfahrungen in High-Performance-Team dargestellt. Doch eine entscheidende Frage haben wir noch nicht gestellt: Wie kann ich anderen vertrauen, wenn ich mir selbst nicht vertraue? Selbstvertrauen als Ausgangspunkt für vertrauensvolle Führung Vertrauen ist kein einfacher Appell und auch keine bloße Erwartung an andere. Es ist eine bewusste Entscheidung, die Mut erfordert (wir haben die Differenzierung Zutrauen vs. Vertrauen erörtert Vertrauen-vs-Zutrauen-eine-wertvolle-Unterscheidung ) – und dieser Mut beginnt bei uns selbst. Eine der größten Herausforderungen für Führungskräfte besteht darin, Macht abzugeben, Verantwortung zu übertragen und sich verletzbar zu machen . Aber genau hier liegt die eigentliche Kraft von Vertrauen. Erst wenn wir bereit sind, Kontrolle loszulassen und unserem Team echte Verantwortung zu übergeben, kann ein Umfeld entstehen, in dem Vertrauen wächst. Ich sehe jedoch in vielen Unternehmen das Gegenteil: Führungskräfte sichern sich ab, setzen auf Mikromanagement und versuchen, sich unverwundbar zu zeigen. Warum? Weil ihnen oft das Selbstvertrauen fehlt (welchen Effekt diese Unsicherheit auf die Organsiation haben kann, habe ich ja in diesem Artikel erläutert Misstrauen-in-der-Organisationsfuehrung-wenn-Angst-vor-Kontrollverlust-zur-Bremse-wird ). Wer sich selbst nicht zutraut, schwierige Situationen zu meistern, wird es auch anderen nicht zutrauen. So entsteht eine Kultur der Kontrolle – und genau das erstickt Vertrauen im Keim. Selbstvertrauen wächst in schwierigen Momenten Echtes Selbstvertrauen entwickelt sich nicht in Phasen, in denen alles glattläuft. Es entsteht in den Momenten, in denen wir ins Straucheln geraten, in denen wir zweifeln und trotzdem weitermachen. Wenn wir aus eigener Kraft eine Krise überstehen und erfahren: „Ich kann das!“, dann wächst das Vertrauen in die eigene Stärke. Und genau dieses Gefühl brauchen wir als Führungskräfte. Wer gelernt hat, sich selbst zu vertrauen, kann auch anderen Vertrauen schenken, ohne sich bedroht zu fühlen. Vertrauen als Führungsprinzip Es gibt eine einfache Wahrheit: Vertrauen entsteht nicht durch Kontrolle oder starre Regeln, sondern durch echte Verantwortung und Verlässlichkeit. Eine Führungskraft, die sich auf diese emotionale Wette einlässt und Vertrauen schenkt, sagt damit: „Ich glaube an deine Fähigkeiten und an deine guten Absichten. Ich traue dir zu, eigenständig und verantwortungsbewusst zu handeln.“ Und genau diese Haltung schafft Motivation und Engagement. Das heißt nicht, dass wir blind vertrauen sollen. Vielmehr geht es um eine gesunde Balance. Vertrauen braucht Klarheit, nachvollziehbare Entscheidungen und eine offene Kommunikation. Es wächst dort, wo Menschen spüren, dass ihre Führungskraft nicht aus Unsicherheit kontrolliert, sondern aus Überzeugung führt. Vertrauen beginnt bei uns selbst Wenn wir von Vertrauen in Teams sprechen, geht es oft darum, was andere tun sollten. Aber bevor wir von anderen erwarten, dass sie vertrauenswürdig sind, sollten wir uns fragen: Wie sehr vertraue ich mir selbst? Selbstvertrauen ist die Basis für eine Kultur des Vertrauens. Wer Kontrolle loslässt, Verantwortung teilt und Vertrauen vorlebt, schafft ein Umfeld, in dem sich Menschen mit Eigenverantwortung, Engagement und echter Zusammenarbeit einbringen können. Ohne Selbstvertrauen bleibt jede Vertrauensinitiative ein Lippenbekenntnis. Doch wer bereit ist, Vertrauen in sich selbst zu setzen, wird erleben, dass Vertrauen sich vervielfacht – in Teams, in Organisationen und in der Art, wie wir zusammenarbeiten.

Authentizität wird oft als eines der höchsten Ideale in zwischenmenschlichen Beziehungen betrachtet. Vor allem im Führungskontext – als Erwartung an heutige Führungskräfte – spielt diese Forderung eine immer größere Bedeutung. Führungskräfte sollen alles in sich vereinen. Doch wie authentisch können wir wirklich sein, insbesondere in komplexen sozialen Systemen wie Organisationen, Teams oder Gesellschaften? Der Begriff Authentizität wird häufig mit Selbsttreue, innerer Kohärenz und der Fähigkeit, „man selbst zu sein“, gleichgesetzt. Doch genau das wirft die Frage auf, ob Authentizität in sozialen Kontexten tatsächlich umsetzbar ist – oder ob sie zwangsläufig eingeschränkt wird. Wenn wir einmal eine Position abseits des Üblichen einnehmen und an uns selbst beobachten, wie unser Verhalten sich der aktuellen Umwelt – im Sinne des sozialen Systems, z.B. Familie, Sportverein, Stammtisch, Unternehmen, etc. – ändert und anpasst, muss doch die Forderung nach wirklicher Authentizität hinterfragt werden, oder? Rollen und Erwartungen in sozialen Systemen In sozialen Systemen sind Individuen stets von Rollen geprägt, die sie einnehmen. Eine Rolle definiert, was von einer Person erwartet wird, unabhängig von deren individuellen Überzeugungen oder Gefühlen. Diese Erwartungen sind oft so dominant, dass sie die Wahrnehmung der eigentlichen Person überlagern. Eine Führungskraft soll beispielsweise entscheidungsfreudig und selbstbewusst wirken, ein Mitarbeitender loyal und effizient sein. Solche Erwartungen entstehen aus der Funktion, die die Rolle im System erfüllt, und sind losgelöst von der Individualität der Person. Das Spannungsfeld zwischen Rolle und Persönlichkeit macht es schwer, authentisch zu bleiben. Authentizität wird oft als die Übereinstimmung zwischen dem inneren Selbst und dem äußeren Verhalten definiert. Doch was passiert, wenn die Erwartungen der Rolle dieser Übereinstimmung im Weg stehen? Muss die Führungskraft ihre Unsicherheit zeigen, um authentisch zu sein, oder sollte sie ihre Rolle erfüllen und Zuversicht vermitteln? Hier zeigt sich die Herausforderung, Authentizität in einem System zu leben, das Rollen klare Regeln und Erwartungen vorgibt. Der Mechanismus der Rollen und Personas Eine Persona ist die nach außen gerichtete Facette einer Person, die bewusst oder unbewusst den Erwartungen des sozialen Systems entspricht. Während eine Rolle die strukturellen Anforderungen beschreibt, zeigt die Persona, wie eine Person diese Rolle ausfüllt. Der Mechanismus dahinter ist, dass soziale Systeme Stabilität benötigen, die durch Vorhersehbarkeit erreicht wird. Eine Führungskraft wirkt berechenbar, wenn sie konsistent handelt und sich an die Rollenerwartungen hält, selbst wenn sie innerlich andere Überzeugungen hat. Dieser Mechanismus schafft einerseits Vertrauen und Stabilität, fordert jedoch von der Person, sich selbst zurückzunehmen. Es entsteht eine Diskrepanz zwischen dem Wunsch, „echt“ zu sein, und der Notwendigkeit, den Erwartungen gerecht zu werden. Diese Diskrepanz ist die zentrale Herausforderung für Authentizität in sozialen Systemen. Die Forderung nach Authentizität ist eine paradoxe Herausforderung. In modernen Arbeitswelten und Beziehungen wird häufig Authentizität gefordert, doch diese Forderung ist oft paradox. Einerseits erwarten soziale Systeme, dass Individuen ihre Rollen vorhersagbar ausfüllen. Andererseits wird gleichzeitig verlangt, dass sie „authentisch“ sind, also unverfälscht und nahbar wirken. Diese beiden Anforderungen können sich widersprechen. Da im ersten Fall die Zuschreibung an der Rolle festgemacht wird und im zweiten Fall der Persönlichkeit. Die Beobachtung einer Person ist jedoch nicht die Beobachtung der Persönlichkeit, sondern immer auch die des Kontextes. Erstes Beispiel: Einer meiner ersten Flüge als Fluglehrer war die Einsatztauglichkeits-Überprüfung eines Flieger-Kollegen. Jemand, mit dem ich gemeinsam ein gutes Stück des Weges zum Piloten gegangen bin. Leider war die Leistung des Kameraden in diesem Checkflug nicht auf dem Niveau, welches die Vorgaben forderten. Ergo, meine Entscheidung als Fluglehrer war, ihn nicht bestehen und damit einsatztauglich zu lassen. Was war hier dominant? Meine Rolle als Fluglehrer, meine Rolle als Kamerad oder gar meine Rolle als Freund? War ich aus der Perspektive meiner Persönlichkeit authentisch? Zweites Beispiel: Ein Arzt wird von seinen Patienten als professionell und sachlich erwartet, doch gleichzeitig wünschen sich viele Patienten Einfühlungsvermögen und persönliche Nähe. Diese Erwartungen können in Konflikt geraten, wenn der Arzt beispielsweise emotional auf einen schweren Fall reagiert und dabei das Bild des kühlen, sachlichen Experten bricht. Ist er dann authentisch oder hat er die Erwartungen seiner Rolle verfehlt? Das Spannungsfeld Rolle und Selbst Die Schwierigkeit, authentisch zu sein, liegt in der Balance zwischen der eigenen Identität und den Anforderungen der sozialen Umwelt. Authentizität bedeutet nicht, uneingeschränkt jedem Impuls oder Gefühl zu folgen, sondern vielmehr, die eigene Persönlichkeit in den Rahmen der Rolle einzubringen. Es ist eine bewusste Entscheidung, wie viel von sich selbst man zeigt, ohne die Erwartungen des Systems zu enttäuschen. Eine Führungskraft kann beispielsweise ihre Werte und Überzeugungen durch ihre Entscheidungen einfließen lassen, ohne jede Unsicherheit oder persönliche Meinung öffentlich zu machen. Authentizität zeigt sich dann in der Ehrlichkeit und Konsistenz, mit der sie ihre Rolle ausfüllt. Sie ist damit abgelöst von der Persönlichkeit und eine Zuschreibung des Systems an die Rolle und der Beobachtung. Daraus ergeben sich fundamentale Grenzen der Authentizität, die durch folgende Faktoren definiert werden: Druck zur Anpassung: Soziale Systeme benötigen stabile Rollen, die reibungslos funktionieren. Wer sich zu weit von der Rollenerwartung entfernt, riskiert Ausgrenzung oder Konflikte. Angst vor Ablehnung: Menschen passen ihr Verhalten oft an, um akzeptiert zu werden, was dazu führen kann, dass sie Aspekte ihrer Persönlichkeit verbergen. Machtstrukturen: Hierarchien erschweren es, authentisch zu sein, da das Risiko höher ist, die Erwartungen derjenigen zu enttäuschen, die über Macht verfügen. Diese Faktoren machen deutlich, dass Authentizität in sozialen Systemen nicht grenzenlos möglich ist. Sie wird immer wieder von äußeren Zwängen eingegrenzt. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Authentizität ein wertvolles Ideal aber auch ein nicht erreichbares. Statt dem Streben nach Erfüllung dieser Erwartungen zu erliegen, sollte sie als Reflexionsfläche dienen um Klarheit darüber zu bekommen, welche Erwartungen das soziale System an die eigene Persona bzw. Rolle stellt. Das erlaubt etwaige Abweichungen zu erkennen und damit bewusster umzugehen. Authentizität ist in sozialen Systemen weniger ein Zustand als ein Prozess. Es geht darum, die Balance zwischen Anpassung und Selbsttreue immer wieder neu auszutarieren und bewusst Entscheidungen zu treffen, die sowohl der eigenen Identität als auch den Anforderungen des Systems gerecht werden. Und bedeutet das nun im Bezug auf die Eingangsfrage: Können wir überhaupt authentisch sein? Die Frage, ob Menschen in sozialen Systemen authentisch sein können, ist komplex. Rollen und Erwartungen fordern oft Anpassung, während gleichzeitig Authentizität verlangt wird. Authentisch zu sein bedeutet in diesem Kontext nicht, die eigene Persönlichkeit isoliert zu bewerten, sondern vielmehr der Abgleich zwischen Persönlichkeit und Erwartungen des sozialen Systems in dem ich mich bewege. Es ist ein Balanceakt, der Reflexion, Mut und die Fähigkeit erfordert, zwischen Anpassung und Selbsttreue zu vermitteln. Dabei wird klar: Menschen können die Forderung nach Authentizität nicht vollständig erfüllen, da sie immer an die Erwartungen des sozialen Systems gebunden sind. Was sie erfüllen, ist die Erwartung an die Persona – die nach außen gerichtete, rollengeprägte Seite ihres Selbst. Authentizität wird somit immer auch eine Frage des Kontextes. Der Führungsalltag ist ein Leben mit Paradoxien!
Es war ein Routineflug – zumindest für die ersten Minuten. Auf dem Weg ins Einsatzgebiet waren wir guter Dinge. Es stand uns ein spannender Einsatz bevor, das Wetter war perfekt, und wir freuten uns darauf, auch an diesem Tag Gutes zu tun. Doch die Spannung kam anders als erwartet: 30 Minuten nach dem Start meldete sich unser linkes Triebwerk mit instabilen Verdichterdrehzahlen – ein klares Anzeichen für ein technisches Problem und ein potenzieller Triebwerksausfall. Die ersten Sekunden waren von einem drückenden Schweigen und einem kurzen Moment der Unsicherheit geprägt. "Always be prepared for the unexpected" war eines unserer Mantras, und dieser Moment brachte uns in eine Lage, in der Vertrauen und Misstrauen gleichermaßen gefragt waren. Nach einem kurzen, wortlosen Austausch mit meinem Co-Piloten – einem fragenden Blick und einem stillen „Echt jetzt?“ – griffen unsere Routinen nahtlos ineinander. Mein Co-Pilot zog die Checkliste hervor, ein Werkzeug, das in solchen Situationen wie ein Rettungsanker wirkt. Schritt für Schritt arbeiteten wir die Prozedur ab. Die klare Anweisung lautete: Triebwerk abschalten. Als mein Co-Pilot, mit einem leicht ungläubigen Blick, fragte: „Du willst doch nicht wirklich das Triebwerk abstellen?“, war meine Antwort kurz und bestimmt: „Oh doch.“ Die Entscheidung fiel schnell, aber nicht leichtfertig. Unsere trainierten Abläufe liefen automatisch weiter. Das vermeintlich defekte Triebwerk wurde kontrolliert heruntergefahren und kam schließlich zum Stillstand. So weit, so gut. Doch die Arbeit war damit nicht beendet. Die Landung musste vorbereitet, die Crew gebrieft und die Situation laufend überwacht werden. Kommunikation unter Stress – nicht trivial, sondern komplex – war in dieser Phase überlebenswichtig. Mit nur einem funktionierenden Triebwerk erhöhte sich die Komplexität unseres Fluges erheblich. Einen Hubschrauber zu fliegen ist von Natur aus anspruchsvoll, doch mit einem ausgefallenen Triebwerk wird es zur echten Bewährungsprobe. Nach etwa 30 angespannten Minuten setzten wir zur Landung an – sicher, unversehrt und um eine wertvolle Erfahrung reicher. Solche Momente, so nervenaufreibend sie auch sein mögen, schweißen ein Team zusammen und stärken die Resilienz. Sie zeigen, dass es eine Balance aus Vertrauen und Misstrauen förderlich sein kann und die Stabilität und Handlungsfähigkeit auch in Krisen garantiert. Vertrauen und Misstrauen sind zwei Seiten derselben Medaille Diese kurze Geschichte zeigt, wie Vertrauen und Misstrauen in einer konkreten, akuten Krisensituation zusammenwirken, um Stabilität und Sicherheit zu schaffen. Doch diese Mechanismen enden nicht nach der Landung. Auch auf einer langfristigen Ebene, etwa in Organisationen, spielen Vertrauen und Misstrauen eine zentrale Rolle. Die Grundlage für Handlungsfähigkeit Vertrauen gibt uns Sicherheit, auch unter Druck Entscheidungen zu treffen. Es stabilisiert Erwartungen und schafft die Grundlage für effektives Handeln: Vertrauen in Prozesse: Die Checkliste war unser Leitfaden. Sie nahm uns die Unsicherheit und erlaubte uns, schnell und gezielt zu handeln. Organisationen schaffen ähnliche Stabilität durch klare Strukturen, bewährte Methoden und transparente Kommunikation. Vertrauen ins Team: Zwischen meinem Co-Piloten und mir bestand ein gegenseitiges Vertrauen. Jeder wusste, dass der andere seine Aufgaben kompetent und zuverlässig erfüllt. Langfristig fördert Vertrauen in Teams die Zusammenarbeit und steigert die Produktivität. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten: Dieses Vertrauen resultiert aus Training und Erfahrung. In Organisationen spiegelt sich dies wider, wenn Mitarbeitende auf ihre Kompetenzen vertrauen und ihre Entscheidungen mutig treffen können. Misstrauen ist ein Schutzmechanismus Misstrauen hat in der Geschichte eine ebenso wichtige Rolle gespielt. Es war kein Problem, sondern ein Mechanismus, der uns dazu brachte, Risiken bewusst zu analysieren und zu minimieren: Misstrauen gegenüber der Technik: Die instabile Drehzahl des Triebwerks war ein klares Warnsignal. Wir nahmen es ernst und entschieden uns für die sichere, wenn auch anspruchsvollere Option: den Flug mit nur einem Triebwerk fortzusetzen. Kritisches Hinterfragen: Die Rückfrage meines Co-Piloten – „Du willst doch nicht wirklich das Triebwerk abstellen?“ – war ein Ausdruck von gesundem Misstrauen. Es stellte sicher, dass die Entscheidung reflektiert und abgesichert war. Und was heißt das für Organisationen? In sozialen Systemen sind Vertrauen und Misstrauen grundsätzlich immer vorhanden oder zumindest potenziell emergent. Beide sind unverzichtbare Mechanismen, die es sozialen Systemen ermöglichen, mit Unsicherheiten und Komplexität umzugehen. Ob eines von beiden dominanter ist oder ob sie gleichermaßen wirken, hängt jedoch stark von den spezifischen Kontextbedingungen und strukturellen Rahmenbedingungen des Systems ab. Es gibt jedoch keine sozialen Systeme, die vollständig ohne Vertrauen oder Misstrauen auskommen könnten. Die Mechanismen von Vertrauen und Misstrauen wirken nicht nur in akuten Krisensituationen wie in der Geschichte, sondern auch auf einer systemischen Ebene in Organisationen: Vertrauen fördert Stabilität und Effizienz In Organisationen schafft Vertrauen Klarheit in Abläufen, stärkt die Zusammenarbeit und ermöglicht eine schnelle Entscheidungsfindung. Langfristig ist Vertrauen der Grundstein für eine gesunde Unternehmenskultur und eine belastbare Arbeitsatmosphäre. Misstrauen deckt Schwächen und Widersprüche auf Misstrauen ist nicht negativ, sondern ein Warnsignal. Es wirkt in ähnlicher Form stabilisierend, lenkt den Fokus jedoch in andere Bereiche des sozialen Systems. Es zeigt, wo Rahmenbedingungen oder Prozesse dysfunktional sind. Organisationen können Misstrauen nutzen, um strukturelle Probleme zu identifizieren und Verbesserungen vorzunehmen. Praktische Lehren für Organisationen Die Geschichte zeigt, dass Vertrauen und Misstrauen Hand in Hand arbeiten, um Stabilität zu schaffen. Organisationen können daraus wichtige Lektionen für ihre langfristige Entwicklung ziehen: Vertrauen aufbauen: Klare Prozesse, regelmäßige Schulungen und offene Kommunikation schaffen die Grundlage für Vertrauen. Gesundes Misstrauen nutzen: Kritisches Hinterfragen und die Analyse von Risiken helfen, blinde Flecken zu vermeiden und Schwachstellen zu beheben. Widersprüche aufdecken: Organisationen sollten Misstrauen als wertvolles Signal nutzen, um strukturelle Dysfunktionalitäten und Widersprüche gezielt anzugehen. Die Balance aktiv gestalten: Mechanismen wie Feedback-Schleifen und transparente Entscheidungsprozesse können helfen, Vertrauen und Misstrauen in einem gesunden Gleichgewicht zu halten. Und nun? Wie bei unserem Flug mit dem defekten Triebwerk gilt auch in Organisationen: Vertrauen ist ein elementarer Faktor in High-Performance -Teams schließt jedoch Misstrauen nicht aus. Auch Misstrauen wirkt in sozialen Systemen – Cockpit oder Organisationen – stabilisierend und entfaltet unter bestimmten Bedingungen förderliche Wirkung. Was natürlich nicht als Aufruf verstanden werden soll, Misstrauen in Ihrer Organisation zu fördern. Jedoch sollten wir dem Mechanismus etwas weniger Ideologisch gegenüber stehen, als es in den vorherrschenden Diskussionen heute üblich ist. Denke Sie einmal darüber nach. Welche Mechanismen nutzen Sie in Ihrem Team oder Ihrer Organisation, um Vertrauen und Misstrauen in Balance zu halten? Wo könnte gesundes Misstrauen Ihnen helfen, Stärken zu entfalten und Risiken zu minimieren?

Dieser Artikel ist allen Technikern und Ingenieuren gewidmet, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe. Sie haben ein hervorragend gewartetes Flugzeug bereitgestellt, das es mir ermöglicht hat, meine Missionen sicher und erfolgreich zu fliegen. Danke für all die Jahre der Unterstützung und des Vertrauens. Was braucht es, damit ein Team Höchstleistungen erbringen kann? Die Antwort lautet: Vertrauen. Hochleistungsteams benötigen eine starke Vertrauensbasis – ohne Vertrauen kann keine Spitzenleistung erbracht werden. Das Vertrauen, das ich in mein Technikteam hatte, war der entscheidende Faktor für unseren Missionserfolg. Es beruhte auf zwei grundlegenden Komponenten: Praktisches Vertrauen – das sich aus der Kompetenz und dem Fachwissen der Techniker ergab. Emotionales Vertrauen – das durch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gewachsen ist. Darüber hinaus hat Vertrauen eine weitere, essenzielle Funktion: Es wirkt als Mechanismus zur Reduktion von Komplexität , was besonders in hochdynamischen Umfeldern von zentraler Bedeutung ist. Vertrauen in Aktion Bei vielen Einsätzen stand das Flugzeug bereits startbereit auf dem Deck. Wenn der Alarm ertönte, hatten wir keine Zeit, das Flugzeug zu überprüfen. Wir stiegen ein, schnallten uns an und starteten. Es war keine Sekunde Raum für Zweifel an der Wartung des Flugzeugs oder daran, ob die Techniker ihre Arbeit korrekt ausgeführt hatten. Dieses Vertrauen war der Schlüssel, um effizient und sicher zu arbeiten. Dieses Vertrauen entstand nicht nur durch kontinuierliche Abstimmung und Resonanz innerhalb des Teams, sondern wirkte auch komplexitätsreduzierend: Anstatt die Vielzahl möglicher Unsicherheiten im technischen Zustand des Flugzeugs zu berücksichtigen, konnten wir uns voll auf unsere Mission konzentrieren. Vertrauen vereinfachte die Situation und gab uns die notwendige Klarheit und Sicherheit, um schnell und zielgerichtet zu handeln. Ohne diese starke Vertrauensbasis wäre das nicht möglich gewesen. Die sieben Säulen des Vertrauens Aus meiner Erfahrung heraus baut sich Vertrauen auf sieben wesentlichen Säulen auf: Ein gemeinsames Ziel Effektive Kommunikation Ehrlichkeit Verantwortlichkeit Transparenz Beziehungsaufbau Zuverlässigkeit Warum sind diese Säulen wichtig? Gemeinsames Ziel Ein gemeinsames Ziel gibt dem Handeln Sinn und schafft eine gemeinsame Basis für alle Beteiligten. Es stärkt die Verbindung innerhalb des Teams. Wer jemals eine Herausforderung gemeinsam mit anderen gemeistert hat, weiß, wie tief diese Erfahrung die Bindung zueinander vertieft. Dieses gemeinsame Ziel bildet die Grundlage für die systemische Kohärenz und sorgt dafür, dass alle Elemente des Teams in dieselbe Richtung wirken. Effektive Kommunikation Es kommt nicht nur darauf an, was Sie sagen, sondern auch wie Sie es sagen. Kommunikation muss klar, direkt und respektvoll sein. Missverständnisse oder Unsicherheiten beeinträchtigen die psychologische Sicherheit des Teams und erschweren den Aufbau von Vertrauen. Eine klare Kommunikation erzeugt Resonanz , indem sie Missverständnisse minimiert und sicherstellt, dass sich die Teammitglieder aufeinander abstimmen können. Ehrlichkeit Ehrlichkeit ist ein zentraler Faktor für psychologische Sicherheit. Auch wenn sie manchmal unangenehm sein kann, schafft sie langfristig Vertrauen und fördert die Zusammenarbeit. In einem resonanten System wird Ehrlichkeit als offener Austausch verstanden, der Unsicherheiten reduziert und Stabilität schafft. Verantwortlichkeit Verantwortlichkeit bedeutet, für Entscheidungen und Fehler einzustehen – besonders in schwierigen Momenten. Ein guter Anführer schützt sein Team, nimmt die Verantwortung auf sich und zeigt Rückgrat, wenn Probleme auftreten. Diese Haltung stärkt die Rückkopplungsprozesse , indem sie das Vertrauen stabilisiert und die Dynamik des Teams positiv beeinflusst. Transparenz Transparenz bedeutet, Informationen offen zu teilen und nichts zurückzuhalten. Teams merken, wenn etwas verschwiegen wird, was das Vertrauen zerstören kann. Transparenz stärkt hingegen die Glaubwürdigkeit und verhindert Missverständnisse. Sie bildet die Grundlage für emergentes Vertrauen , da offene Kommunikation die wechselseitige Abstimmung erleichtert. Beziehungsaufbau Ohne Beziehungen kein Vertrauen, und ohne Vertrauen keine Beziehungen. Menschen sind soziale Wesen und benötigen zwischenmenschliche Bindungen, um effektiv zusammenzuarbeiten. Beziehungen schaffen einen Resonanzraum, in dem Vertrauen wachsen kann. Dieser Raum ermöglicht eine tiefere Abstimmung der Teammitglieder und sorgt für langfristige Stabilität. Zuverlässigkeit Tun Sie, was Sie sagen, und sagen Sie, was Sie tun. Konsistentes Verhalten schafft Vorhersehbarkeit, was die psychologische Sicherheit und das Vertrauen im Team stärkt. In einem resonanten System entsteht Zuverlässigkeit durch kontinuierliche positive Rückkopplung – wenn Erwartungen immer wieder erfüllt werden, festigt sich das Vertrauen. Vertrauen als Komplexitätsreduktion Ein zentrales Merkmal von Vertrauen ist, dass es die Komplexität eines Systems reduziert. In einem dynamischen Umfeld gibt es unzählige Unsicherheiten und potenzielle Risiken. Vertrauen reduziert diese Unsicherheiten, indem es stabile Erwartungen schafft und den Fokus auf das Wesentliche lenkt. Wie reduziert Vertrauen Komplexität? Antizipation von Handlungen: Vertrauen erlaubt es, die Handlungen und Entscheidungen anderer vorauszusehen. Ein Teammitglied muss nicht jeden Schritt überprüfen oder hinterfragen, weil es darauf vertrauen kann, dass die anderen zuverlässig arbeiten. Fokus auf das Wesentliche: Anstatt Ressourcen auf Kontrolle und Absicherung zu verwenden, ermöglicht Vertrauen, sich auf die zentralen Aufgaben zu konzentrieren. Stabilisierung des Systems: Vertrauen schafft eine stabile Erwartungsstruktur, die in einem dynamischen Umfeld Orientierung gibt und Unsicherheiten minimiert. In den beschriebenen Einsätzen war Vertrauen der Schlüssel, um die Komplexität der Situation zu bewältigen. Anstatt uns auf potenzielle Fehlerquellen oder Unsicherheiten zu konzentrieren, konnten wir uns voll auf unsere Mission fokussieren. Vertrauen machte das System effizient und handlungsfähig. Fazit: Vertrauen als Basis für Effizienz und Stabilität Vertrauen ist kein statischer Zustand, sondern ein dynamisches Phänomen, das sich aus den Interaktionen eines Teams entwickelt. Es wirkt als emergentes Resonanzphänomen , das durch Synchronisation und wechselseitige Abstimmung entsteht. Gleichzeitig ist Vertrauen ein effektiver Mechanismus zur Reduktion von Komplexität , der Orientierung und Stabilität in dynamischen Umfeldern bietet. Wenn Sie Höchstleistungen in Ihrem Team erreichen möchten, müssen Sie nicht nur Raum für Resonanz schaffen, sondern auch die komplexitätsreduzierende Wirkung von Vertrauen bewusst fördern. Vertrauen entsteht nicht zufällig, sondern durch bewusste Führung und systemische Abstimmung. Kein Vertrauen = keine Höchstleistung.

Dynamische Märkte fordern Unternehmen kontinuierlich heraus, sich schnell und effektiv anzupassen. Dynamik entsteht immer dann, wenn Überraschungen auftreten – also Ereignisse, die unerwartet und unvorhersehbar sind. Manchmal hat ein Wettbewerber eine neue Idee, manchmal kommt ein Kunde mit einem unerwarteten Problem. Diese Situationen erzeugen Marktdruck und Dynamik. Unternehmen spüren diesen Druck und müssen Wertschöpfung abseits der Norm liefern. Um die Wertschöpfung aufrechtzuerhalten, braucht es dynamik-resiliente Strukturen. Eine der größten Schwächen traditioneller Unternehmensorganisationen liegt in ihrer Struktur: Sie sind in funktionale Silos unterteilt – Abteilungen, die auf die effiziente Erledigung gleichartiger Aufgaben spezialisiert sind. Dies kann im Alltag gut funktionieren, doch wenn ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät oder wiederholt von hochdynamischen Märkten irritiert wird, kann das gesamte System ins Wanken geraten. Die starke Abhängigkeit innerhalb einer auf Effizienz ausgerichteten Abteilungsorganisation macht diese Strukturen besonders anfällig und fragil gegenüber äußeren Veränderungen. Man könnte eine traditionelle Abteilungsorganisation mit einem Amt vergleichen: Hervorragend geeignet für die Verwaltung von Normalzuständen, aber äußerst ungeeignet für den Umgang mit Ausnahmen und dynamischen Herausforderungen. Aus meiner Sicht sollten Start-ups die klassische Abteilungsstruktur kritisch hinterfragen, da sie oft nicht zur Realität dynamischer Marktumgebungen passt. Es gibt Alternativen! Eine vielversprechende Möglichkeit, Start-ups dynamik-resilient zu gestalten, ist die Umstellung auf teilautonome Zellen. Jede Zelle übernimmt eigenverantwortlich einen Teil des Geschäfts und ist weniger zentral gesteuert. So können sich Zellen flexibel an verändernde Marktbedingungen anpassen. Jede Zelle entwickelt dabei ihre eigenen spezifischen Eigenschaften, die andere Zellen nicht unbedingt teilen. Diese zellenartige Organisation mag auf den ersten Blick weniger effizient wirken. Tatsächlich erscheint sie aus der Perspektive der klassischen BWL-Lehre als verschwenderisch. Doch Effizienz ist längst nicht mehr das alleinige Kriterium für wirtschaftlichen Erfolg. Aspekte wie Qualität, Geschwindigkeit, Flexibilität und das Erleben von Beziehungen spielen in modernen Unternehmen eine zunehmend wichtigere Rolle – auch wenn Managemententscheidungen oft noch von traditionellen Effizienz-Narrativen geprägt sind. Zellenorganisationen bieten zahlreiche Vorteile, besonders in dynamischen Marktumgebungen. Sie sind dezentral aufgebaut, und nahezu alle Kompetenzen, die nötig sind, um direkt am Markt zu agieren, sind innerhalb einer Zelle vereint. Stirbt eine Zelle, können die anderen unabhängig davon weiterarbeiten – ein äußerst resilienter Ansatz. Dieser Ansatz kann in hochdynamischen Märkten entscheidend sein. Dynamik entsteht durch Unvorhersehbares, also durch Überraschungen, die Unternehmen irritieren. Diese Überraschungen erfordern Wertschöpfung jenseits von Normalzuständen. Dafür braucht es Strukturen, die auf Dynamik ausgelegt sind. Interessanterweise lassen sich solche Organisationsstrukturen auch in traditionellen Unternehmen beobachten, meist in Krisensituationen. Sie werden dann "Taskforce" genannt und bewusst aus der klassischen Abteilungsstruktur herausgelöst. Diese Taskforces arbeiten autonom, um ein Krisenproblem zu lösen, bevor sie wieder aufgelöst und in die Abteilungsstruktur integriert werden – bis zur nächsten Krise.

Das Wachstum von Start-ups - Erwachsen werden tut manchmal weh Alles beginnt mit einer Idee. Einer Idee für ein Produkt, eine Service-Lösung, eine Marktlücke. Alles beginnt mit einer Idee für die Lösung eines Marktproblems, eines Kundenproblems. So oder so ähnlich beginnen viele Start-ups ihren Weg. Viele sehr erfolgreich, andere weniger. Ein Umfeld hoher Dynamik. Aber das macht ja auch einen Teil des Reizes von Gründungen, Start-ups aus. Es existiert eine Idee, es wird ausprobiert, was funktioniert hat Bestand, was nicht funktioniert stirbt. So dynamisch das Kommen und Gehen, so dynamisch ist auch die Art, wie diese jungen Unternehmen arbeiten. Sie machen einfach. Die in „etablierten“ Unternehmen und Konzernen vorhandene Denkweise der Prozess-Orientierung ist wenig bis überhaupt nicht ausgeprägt. Es besteht ein Problem, das muss gelöst werden. Wenn kein Prozess Vorgaben macht, wird danach gehandelt, was logisch erscheint und sich richtig anfühlt. Mit Irrtümern wird positiv umgegangen und als Lern-Chance gesehen. Start-ups schleppen den ganzen „blauen Unrat“, der sich oft in Vorgaben, Prozessen, Handlungsanweisungen etc. abbildet, nicht oder nur im geringen Maße mit sich herum. Die Organisation ist schlicht, klein und geprägt davon Lösungen zu schaffen. Kurzum, die Kommunikationsmuster orientieren sich an der Lösungsfindung. Das macht sie dynamisch und resonanzfähig mit dem Markt. Was macht der Markt? Die relevanten Umwelten von Unternehmen, die Märkte, sind heute viel dynamischen als noch vor 20-30 Jahren. Ein hohes Maß an Marktdynamik heißt ein hohes Maß an Überraschungen, von Unvorhersehbarkeit und damit auch Unsicherheit. Wo bisher Planungen gereicht haben, müssen nun Strategien her. Wo Prozesse bisher Planbarkeit gesichert haben, treten nun Unsicherheiten über die Zukunft auf. Einige grundsätzliche Herausforderungen sind - Dynamik heißt große Anzahl an Überraschungen im Markt - Hohe Dynamik bedeutet Komplexität - Komplexität des Marktes fordert Komplexität der Lösungen - Komplexität der Lösung benötigt Anpassungsfähigkeit der Organisation - Anpassungsfähigkeit einer Organisation erhöht gleichzeitig die Komplexität in der Organisation - hoher Druck des Wachstum durch Eigentümer, Shareholder, Investoren - Druck der Skalierung des Business Diese Anforderungen bzw. Rahmenbedingungen von dynamischen Märkten fordern Unternehmen immer stärker heraus, sich von den klassischen Denkansätzen zu lösen und neue Wege zu gehen, um mit der Dynamik umzugehen. Die Unternehmen, denen dieses gelingt, die den Mut haben, sich von bekannten Ordnungsmustern zu verabschieden und die Unsicherheit im Übergang zu akzeptieren, nenne ich dynamikrobust. Start-ups sind dynamisch, da sie meist keine klassischen organisatorischen Denkmuster haben. Es ist ja alles neu. Das verschafft ihnen im Umgang mit Marktdynamik einen entscheidenden Vorteil. Aber dann! Und eines Tages kommt der Punkt, an dem die beobachtbare innere Dynamik mehr und mehr chaotisch wirkt. Das Start-up ist nunmehr an einem Punkt des Wachstums, an dem weitere Mechanismen Einfluss nehmen. Es entsteht der gefühlte Handlungsdruck etwas anders machen zu müssen. Etwas mehr „seriöses“ Unternehmen und etwas weniger „chaotisches“ Start-up. Es müssen Regeln und Prozesse her um dem Chaos Einhalt zu gebieten. Die Organisation soll erwachsen werden. Man schaut zu den Großen und tappt schnell in eine gefährliche Falle. Es werden sich Dinge von den großen Organisationen abgeschaut. „Wenn die es so machen, muss es ja gut sein, ansonsten wäre sie ja nicht erfolgreich“….. höre ich immer wieder. Es wird sich professionalisiert, so der Anspruch. Die Falle! Einer Organisation mit wenigen Mitarbeitenden erlaubt man mehr „Chaos“ als einer mit mehreren tausend Mitarbeitenden. Wo es bei Start-ups noch als chaotisch charmant abgetan wird, unterstellt man größeren Organisationen gerne Unprofessionalität. Ob Kunden, Investoren, Eigentümer, alle schauen gern „über den Tellerrand“ zu anderen um geordneter zu werden. Das Problem, welches ich beobachte ist, dass diese Professionalisierung oft unreflektiert erfolgt. Es werden Prozesse und Abläufe, Strukturen und Regeln kopiert und ohne Differenzierung übernommen. Man passt sich als Organisation dem „gefühlten“ oder allgemeinen Normal der Wirtschaft an. Andere machen es so, also müssen wir es auch so machen. Management-Berater tun ihr übriges zu diese Tendenz. Die große Gefahr hier ist, dass die Prozesse, Abläufe, Strukturen etc anderer Organisationen nicht gezwungenermaßen auf den eigenen Kontext – Markt-Problem-Lösung – passen. Vor allem nicht allgemein über die gesamten Organisation. Ohne eine präzise Reflektion des eigenen Kontextes und ein Verständnis darüber, wie Organisationen funktionieren, führt diese Kopierwahn u.a. dazu, dass einigen Teilen der Organisation die benötigte Freiheit zur Bewältigung der Marktdynamik genommen wird. Der Organisation wird die Fähigkeit genommen, auf die Marktdynamik zu reagieren. Die oben beschriebene Komplexität im Inneren wird reduziert und passt nicht mehr zur Komplexität des Marktes bzw. zur Marktdynamik. Was ist die Alternative? Es gibt keine allgemeingültige Antwort, sondern nur mögliche Annäherungen an das zu bewältigende Problem. Eine mögliche Resonanzpunkte sind - Schaffen von Erkenntnis, wie Marktdynamik funktioniert und welchen Einfluss diese auf die eigene Organisation hat. - Schaffen von Erkenntnis, wie Organisationen funktionieren und welche Mechanismen beobachtbar sind. - Wie sieht die eigene Realität – Unternehmensrealität – aus? - Wie passt das gefühlte „Normal“ und das beobachtbare „Normal“ anderer aus und wie passt das zum obigen Punkt – eigene Unternehmensrealität - Nichts kopieren, was nicht zur eigenen Wertschöpfungsrealität passt. Die Kunst des Weglassens! - Das kritische Hinterfragen jeder Methode – Methodengläubigkeit unterdrücken. - Aufmerksam für Alternativen sein, die Abseits der üblichen Lehre Lösungen anbieten. Nicht den klassischen Methoden blind vertrauen. - Selbst Denken und Lösungen finden, auch wenn das reine Kopieren einfacher und vordergründig effektiver erscheint. So kann eine Organisation als Start-up wachsen und robust mit der Marktdynamik umgehen. Sie wird dynamikrobust und damit erfolgreich am Markt.
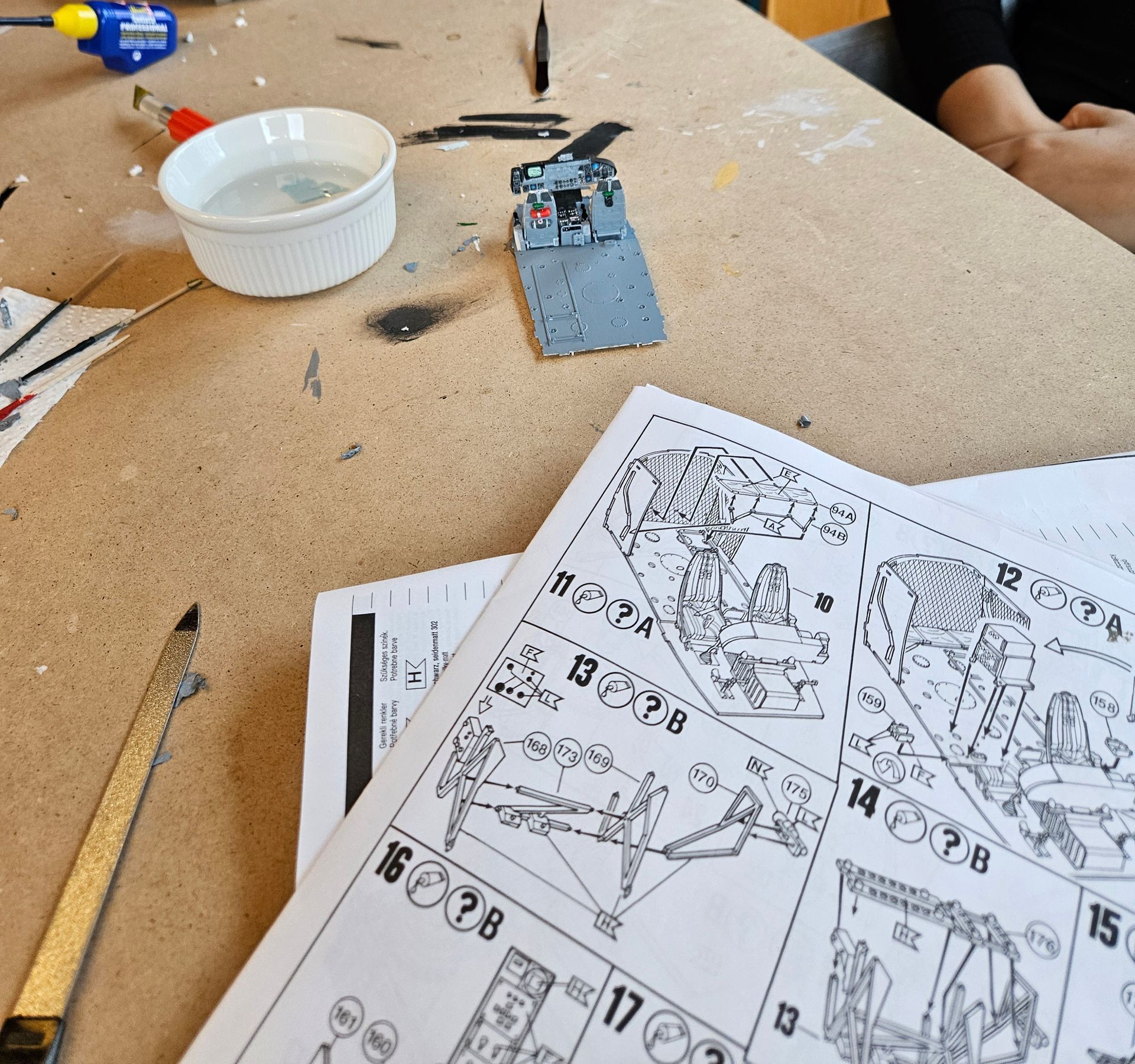
Neulich frönte ich wieder dem gemeinsamen Hobby mit meiner Tochter - Flugzeug-Modellbau. Nachdem wir bereits einen Eurofighter - sie liebäugelt damit, später einmal Eurofighter zu fliegen, war dieses Mal ein Nostalgie-Stück aus meiner Vergangenheit dran- eine Westland Sea Lynx im Maßstab 1:32. Als ich an einem Bauteil im Verlauf des Baus Schwierigkeiten hatte. Der Zusammenbau wollte nicht so recht gelingen, und die Bauanleitung (Rezept / Methode / konserviertes Wissen) gab keinen sachdienlichen Hinweis zur Lösung. Mit der Zeit stieg ein wenig der Ärger in mir hoch, als plötzlich meine Tochter von der Seite mir zurief… ”Paps, das ist ein rotes Problem, das kannst du nicht mit deinem Wissen lösen…ich habe eine Idee! ”Leider hatte ich keine Kamera zur Hand, mein Gesichtsausdruck war oscarreif. Nach dem ersten Moment der inneren Verdutztheit überkam mich ein tiefes herzliches Lachen und das Gefühl der Zufriedenheit .Nicht nur, weil meine Tochter den Traum der Fliegerei verfolgt - wie ich einst - sondern auch weil es eine Bestätigung war, dass sie mir tatsächlich von Zeit zu Zeit zuhört - bei einer 15-Jährigen nicht so offensichtlich Aber auch weil hier eine Generation heranwächst, die Problemlösungen neu denkt. .Als glücklicher “Paps” trat ich einen Schritt zurück und beobachtete, wie meine Tochter ihrem Gefühl freien Lauf ließ und eine Idee zur Lösung des Problems verprobte…erfolgreich. Ein rotes Problem war gelöst. .Probleme sind allgegenwärtig, in jeder Organisation, in jedem Unternehmen werden Probleme gelöst. Wenn alles gut läuft, sind es Probleme des Marktes / Kunden und mit entsprechender Bezahlung findet Wertschöpfung statt. Leider erlebe ich es im Beratungsalltag oft, dass versucht wird, jedes Problem mit Wissen zu lösen. Wissen ist jedoch nur bei bereits bekannten, schon einmal gelösten Problemen hilfreich. Bei neuen, unbekannten und noch nie gelösten Problemen (Überraschungen) nutzt kein Wissen. Hier braucht es Ideen zur Lösung. Ideen basieren auf Gefühle. Gefühle generieren sich ohne Wissen. Im Gegenteil, Wissen kann sogar hinderlich sein, eine Idee zu generieren, da man gefangen ist in den eigenen Denkmustern .Um dieses Dilemma ein wenig aufzulösen, lohnt sich wieder einmal eine Unterscheidung. Die Unterscheidung von blauen und roten Problemen. Blaue Probleme = durch Wissen zu lösen, Rote Probleme = durch Ideen. Diese Denkweise ist immens hilfreich, wenn es darum geht, Probleme zu verstehen.
We had been on our way for 30 minutes when we finally made contact with our mission commander on board the US-Destroyer which has been on scene for some time now. Lacking an asset like us, the request was made to our commanding officer that we help out as a vital asset to our American friends. After the alert we lit the fires and went off towards the scene of action. After we established comms with the mission commander we received a briefing about the tactical situation including threat level and safety distances which depended on what kind of threat we had to expect. Arriving on scene we took station as per our briefing and watched out for the things to come…….of course at this point in time we had no idea how rough things were about to get. But this is a different Story. In situations like this the quality of communication is crucial. Two different nationalities and cultures under normal circumstances is already a challenge but in a high threat scenario it lifts to new highs. How do you communicate and how does your communication change under stress? When under pressure i.e stress, our ability to communicate can degrade rapidly. First thing you´ll lose ist the ability to listen. Your brain will not process the things that your ears pick up. This was alarming in the cockpit and a serious sign of mental overloading. I have witnessed this a few times in my career. Next you lose when stress keeps building up is the ability to speak. At a certain stress level everyone locks up. Mental fixation follows and brain lock up is complete. When this happens immediate reduction of the stress level is paramount. Which isn't that easy to do in a hot mission. We depended on effective communication which wouldn't break down when stress levels rose. For this reason our communication followed three fundamental pillars Clear Concise Context related We used a lot of standard phrases which were directly related to the context in order to reduce complexity. A common set of phrases allowed a clear communication even in high stress situations, which put our communication and what to expect into the adequate context. Again the context shapes the way we behave and communicate. Hence expectations in terms of what reply to expect from the communication partner were set and reduced misunderstanding. To allow a high effective and efficient communication under stress we simplified it. Using context related phrases, free of interpretation or need to read between the lines which allowed us to reduce the complexity and increase effectiveness. And all of this to do one thing and one thing alone to serve the purpose of completing the mission. Communication in teams and organizations is paramount in a high stress, high pressure environment. And yet I observe an ever degrading quality of communication. I observe a more and more focus on non-context related communication than what is relevant for the mission, the task, the objective. Nowadays organizations seem to serve individual expectations of what is said and how it is said, when it is said or even if it is said at all. To serve every individual strive for wellbeing. It seems as if the purpose of communication - allow mission/task completion has been lost on the way or if it has diverged from the original path. What is your expectation in terms of communication? Does the task at hand dominate or your individual needs? How much do personal feelings influence your communication? As a pilot my brain was trained to make use of communication to serve the mission, not the individual. Does this mean we communicated harshly or hurtful to the individual? No, not at all. The cockpit was and is not the place for harsh and hurtful communication. It was, at least in that respect, a quiet place where professionalism took place. But we took our personal feelings out of the equation and focused on what needed to be said without wasting energy and time on whether we respected the very individual expectations. Our “culture” was allowing a mission oriented ,high effective communication leaving personal feelings out. This allowed us to fly the missions we flew and complete the task across different nationalities. What could that mean for you and your teams? Focus on the task ahead Align the communication to serve the task Reduce complexity in the way of communication Leave everything not related to the task aside Be concise but not harsh Acknowledge feelings but don't let them dominate your communication Professionalism is the ability not to take it personal It might not be easy but it is worthwhile.
"This decision was a mistake" or "You made the wrong decision", "what a disastrous decision", we all know these statements only too well, don't we? In most cases, however, they are only an expression of the diluted and misunderstood handling of the construct "error" and the lack of differentiation between error and fallacy in highly dynamic contexts. The small series on the subject of error management comes to an end for the time being summarizing my philosophy about errors, fallacy, decision making in high dynamic markets as well as continuous organizational improvement. In Part 1 “ Error Management - keeping your mouth shut is the worst thing you can do” I described how to deal with real errors and offered some basic requirements to avoid so-called errors. In Part 2 “ Error management Part 2 - when overconfidence is knocking on your door to kill you” I outline an experience in which cockiness and arrogance led to a real mistake and almost to me killing myself. In Part3 “ Error Management part 3 - Maintain aircraft control, analyze situation, take proper action” I describe the difference between error and real mistakes based on a dramatic experience, which almost not only cost my life, but also that of my student pilot. In Part 4 “ Error Management Part 4 - in the absence of knowledge” I used the situations from Part 2 and 3 to explain the difference between fallacy following decision making and real mistakes/errors. In Part 5 - “Error Management Part 5 - The final cut” I would now like to give brief food for thought to think about the differentiation between error and fallacy, the dangerous effect of tolerating errors and the potential of errors and fallacy to improve one's own organization and thus value creation. Food for thought Mistakes happen and are inevitable Real mistakes must not be tolerated, because they damage the organization, the company's added value and thus the customer In the absence of complete knowledge, you have to decide between options Who decides can be wrong, but does not make a mistake If complete knowledge is available , there is only one option and a decision is needless Mistakes can only occur if no decisions have to be made. The unpredictability - see also the article “Preparation vs Planning - the illusion of predictability” - of future developments in dynamic markets/context/environment requires the willingness to make decisions and accept the uncertainty that comes with it Risk taking, acceptance of uncertainty and decision making are directly connected and go hand in hand A fallacy is not a mistake and as such is only an expression of the willingness to make decisions in high dynamic environments Mistakes must not be tolerated and are inevitably subject to consequences in order to protect the organization, the value creation and the customer When real errors are tolerated the organization will slowly learn that laws, processes and specifications are irrelevant and hence the organization will degrade in it´s quality The consequences of mistakes can be depersonalized to increase the improvement potential for value creation When I write that real mistakes must not be tolerated, it seems to contradict my view from Part 1. This statement may even give the impression of a sanction-driven attitude towards dealing with errors. This is by no means the case. Mistakes/errors do not necessarily have to be sanctioned, although they cannot be tolerated. See also Part 3 of the series. I made a real mistake by prematurely taking control of the aircraft -> full knowledge was available and the situation was therefore decision-free. And yet this error was not sanctioned. Rather, the analysis was used to avoid future errors of this type. I personally made sure to do my part to avoid this mistake by re-professionalizing before attempting any training flights of this type again. That's what error management is all about. It's not about finding people responsible in order to sanction them. It's about avoiding mistakes made in the future and letting the organization learn from them -> Adaptation of processes, specifications to the needs of value creation. To do this, it is necessary to understand how these errors come about -> systemic analysis. Do they have a systemic cause or an external, environmental one? A technical or humannic? What can be done to avoid real mistakes of this kind in the future? In today's society and thus also in companies, organizations and teams too often tend to personify mistakes and problems in order to be able to sanction them. How often do we hear the call to blame? The problem is, tah this encourages a less conducive culture that is not geared towards understanding and avoiding the causes of mistakes, continuous improvement and enhancing value creation but rather towards punishing mistakes made, blaming and maintaining status quo, which will also avoid people making valuable decisions just in order to avoid blaming and sanctions. This will inevitably lead to a degradation of value creation for the customer. In the cockpit and in aviation in general, a fatal culture that would not lead to more safety but to less safety with fatal consequences. Error Management is all about understanding and improvement. Mistakes are made, errors occur, we cannot and should not deny this fact. We can only deal with them constructively if we differentiate errors from fallacy following decision making and seek best ways to improve. From my point of view, this is an indispensable element for working together in teams and organizations especially in today's high dynamic markets. Want to learn more about my experience and philosophy in error management and leadership in high dynamic markets? Give me a call, then I´ll fly with you…… .
“The one who makes falsities is never wrong” In Part 4 I´d like to dive into my differentiation between error and error. Not everything that is predominantly defined in these days as an error is in fact an error. This differentiation helps the error management in organizations and allows leaders to focus on improvement to create customer value rather than sanctioning and blaming. It also creates a psychological environment for the teams to make decisions and hence improve organizational efficiency and thereby creating customer value. Let's get started Do you remember my flight in November the year I nearly flew my student and I to our deaths? link to Article Part 3 In the preparation and execution of that flight we made several decisions. Some were adequate, some were not. Some led to error and some just to miscomprehension. Was it a mistake to make this flight that evening? No! Yes? Why? I have observed that there is a growing tendency to label anything that does not happen as intended or predicted as a failure, a mistake, an error. We are still trying to predict any changes, changes in the market, with the customer, in our lives, i.e. we try to make them plannable. This inevitably exposes every decision to an increased risk of conviction. If I decide something and the predicted effect/consequence does not occur, then the decision is perceived and assessed as a mistake. Why? Because the intended effect was not achieved and logically the decision must have been the wrong one. Otherwise the desired effect would have been achieved or the planned consequences would have occurred. Right? In that sense, the decision to make the flight was a mistake. But what are errors and what conditions must be in place for errors to be possible at all? At this point, a small but important distinction. Not everything that does not achieve the desired effect or the desired goal is a mistake. Sometimes it's a fallacy. Seems an miniscule difference but it makes accepting and dealing with consequences of decision making easier and more constructive than to subsume everything under error. Decisions are only necessary where several options are available and one cannot know exactly which is the best option or which option has the best effect for them. So I don't have full knowledge -> absence of full knowledge. Only then do I have to decide on one of the options at all. If I knew exactly which of the available options would achieve the desired effect, a decision would not be necessary and would be obsolete. Because then I would know, it goes like this and only like that. In most cases, especially in highly dynamic contexts/environments, this complete knowledge is not available because high dynamic prevents predictability. This means that two or more options are available and a decision must be made. Therefore, laws, processes and regulations do not create space for decision making. These allow only the option described in the law, process or regulation. The StVO -German road traffic act - stipulates a maximum speed of 50 km/h in built-up areas. Objectively speaking, there is nothing to decide. Of course I can ignore it and drive 100 km/h. But then I made a mistake, an error, which in case of doubt leads to fatal consequences and will certainly be sanctioned. However, if I want to get from A to B, there is an option to drive through the city or take the bypass road. The law allows both options and therefore the situation is not free for the need of decision making. I need to make a decision to increase the likelihood of achieving my goal -> arrive at B. If I now choose the route through the city and then drive halfway into the full closure, then I miscomprehended, but I didn't make a mistake. Even if it feels like it at the moment. So back to my example from Part 3. Was it a mistake to go flying? No it was not! Why? Because all the knowledge was there that could have been there . There was nothing more to know. -> absence of complete knowledge. Because there were more than one option but none was imposing itself. We decided to go flying. We made a decision based on our knowledge at that time. Nobody could have known before the flight that the weather would deteriorate so dramatically towards the end of our flight -> absence of complete knowledge. No law, no procedure, no regulation had deprived us of the space of choice, leaving only one option -> not decision free. Ergo, a decision had to and could be made and thus all the conditions were met not to make a mistake. At least not in this decision. It could, however, lead to a fallacy. It would have been different if, for example, the weather conditions had been so bad that they were below our stipulated weather minimums, or if the forecast had shown such a deterioration. Nothing would have had to be decided here -> free of decision, because the decision has already been made by the specifications of the regulation. If I had still gone flying with my student, the conditions would have been met and I would have made the first mistake of this flight. Did the weather forecaster make a mistake that evening in giving us this weather forecast that didn't predict such a deterioration in conditions? No! Because the existing knowledge/data about the development of the weather situation was as it was. The weather consultant made the decision for this weather consultation on the basis of the existing knowledge. So it wasn't a mistake, it was a fallacy. Errors, decisions and risk-taking are directly linked. Taking the example from Part 2 I made the "decision" to pull into the loop from inverted flight. Was that a mistake? Well, considering the potential consequence, which only luck averted, one would have to say yes. But let's look at this example in the light of what was defined above. Was it a choice of options in the absence of full knowledge? Yes! I could have flown the maneuver like that or not. Was there a need for a decision? Was complete knowledge absent? No! Why? Because in this situation, on that day, at this stage of my training, I already knew that "doing" a loop from inverted flight WITHOUT reducing engine power must lead to increased centrifugal force. The procedure explicitly describes a maneuver like this one -> presence of complete knowledge. And I also had the knowledge that rapid application of centrifugal forces requires the use of physical countermeasures. The knowledge about aerodynamics, physical stress caused by high centrifugal forces and the associated effects was available. I had that knowledge. I also had the knowledge of what could be done to avoid blacking out on this maneuver. From that point of view it was decision-free and I made a mistake. That means I made a mistake. The only option was not to fly the maneuver in this form. It was indecisive. I acted out of recklessness, cockiness or stupidity and committed an almost fatal mistake. Side note Acts of recklessness or high spirits mostly lead to mistakes. They do not always lead to dramatic consequences, just as not every mistake leads to dramatic consequences. Certainly the context of aviation is one with a high potential for dramatic consequences, and yet mistakes happen here too. Nothing and nobody is infallible. We summarize Decisions are only necessary in the absence of complete knowledge When decisions have to be made the potential for errors is negated Decisions can lead to unforeseeable developments, then there is an fallacy, but not a mistake In highly dynamic contexts/ environments, fallacy in decision-making is an unchangeable and acceptable condition, since the development of the future is not foreseeable The higher the dynamics of the context the greater the need for real decisions Mistakes can only be made if no decisions have to be made To be continued in Part 5 - The final cut .

It was again one of those flights that were ill-fated. A night low-flying training flight in the German Bight was planned. The weather wasn't great, not good, but not bad enough to make a clear decision for us. A weather prediction that made my decision, as the responsible flight instructor, once again well-earned money. To fly or not to fly was the question here. My student was already experienced, the training syllabus was pushing and we were eager to get going, so I decided to go flying. As it is so often the case, the decision was accompanied by the statement "we'll give it a try".....Situational awareness and decision making were the main elements of our "Management Framework" CRM - Crew Resource Management. The situation was not brilliant, but, considering all the information, acceptable - a calculated risk. My student was happy, I was happy. It was autumn time and the sun set early again in November this year, so the take-off was planned for a reasonably early time in the evening. After 2 hours of flight time we were to return to the airfield. That was the plan. The further preparation followed the normal procedure and we were able to start the engines as planned. 10 minutes later we went airborne. The northern departure route was in the direction of the Elbe fairway, to give my student the opportunity to practice some low-level flight following the fairway and to warm up. The weather appeared as predicted, not brilliant but good enough. Good enough for government work as we used to say. So we followed the fairway in the direction of Elbe 1 and, after passing the Elbe 1 buoy, began the actual flight content. The course of the flight was as expected and the time literally flew by. Returning home - when things started to go down the drain After a good 90 minutes it was time to take us back home. Especially with these weather conditions, it makes sense to plan some "air" for the unforeseen. So we made our way home towards the coastline. The closer we got to the shoreline, the worse the weather conditions got, the visibility got less and less and the clouds hung unexpectedly low, so that we finally found ourselves about 200 feet above the ground. The radar told me clearly where the shoreline was and when it was time to make the necessary checks and to communicate with the control tower. My student was still the pilot-flying while I took care of navigation, radar and most importantly communications, as I had for the past 2 hours. For 2 hours I had my eyes on the instruments, on the radar image or outside in the dark night, but I wasn't actually flying hands-on. For the pilot, night low level flight over sea means flying according on instruments only. Other than the day when you have your eyes outside. This type of flying, 100 feet above the water surface at night and in bad weather, requires maximum focus and does not forgive any mistakes. In this way, we also avoid switching controls between pilots as much as possible. Apart from that, my student should get as much “sticktime” - actually flying hands-on - as possible. Maintain aircraft control, analyze situation..... At 200 feet we were now entering the clouds, which is not a good idea so close to the shoreline with obstacles rising above 200 feet. The risk of flying into those was immense. With my student flying, I had my focus on the communication and the radar image and neither I nor my student noticed the steadily falling cloud base. When I saw in the corner of my eye that we were entering the clouds, de facto already above the coastline, I reflexively took control of the aircraft, initiated a left turn and descended to get out of the clouds. Let's remember that at this point we were less than 200 feet above the ground. So far so good and everything is controllable if, yes, if I had looked at the flight instruments and not, as happened, out of the cockpit window where there was no visual clue or reference as to our attitude and altitude. There wasn't much to see apart from darkness and my spatial disorientation was complete. I still remember seeing the radar altimeter as the needle went through 50 feet. My years of training kicked in abruptly and I pulled on the collective to gain height while leveling the “wings” to resume normal attitude…..after felt ages - in fact split seconds - got the aircraft back under control with a max power climb, wings level. Heart pounding and knees shaking we made it….so far. We must not have been a split second from hitting the dike west of the airfield kissing ourselves goodbye. In a few seconds we had slipped from a stable flight condition into a "near crash". I struggled with my sensory impressions and my sense of spatial orientation. This was completely out of joint and was telling me something that was not consistent with the instruments. If in doubt, apply the basics If in doubt, the flight instruments are always correct. "Have faith" it said in my head. So “back to basics” and set up the instrument scan…. That's how I managed to get the aircraft into a stable flight condition and stay off the ground...we carefully and safely ascended back into the deep darkness we had just come from. Reaching 150 feet above ground I saw in the right corner of my eye a bright beam of light stretching straight up into the sky....which I came to call the “Finger of God”. This bright beam gave me visual orientation in space again and I was able to realign my feelings with the instruments. I gently banked the aircraft to the right toward the beam of light, being mindful not to get into the next spatial disorientation. It was the outer edge of the spa areas south of Cuxhaven that were still lit up at that time and, in combination with the heavy rain, led to this phenomenon that was anchored in my memory as "Finger of God" from then on. Stable at 100 feet to stay below clouds, we flew slowly along the coastline towards Cuxhaven, hoping to be able to reach the field from the north. As it quickly turned out, it was a naïve hope so that we finally were forced to make an emergency landing in the port of Cuxhaven due to the bad weather conditions. After the whole odyssey we were running low on fuel and a double engine failure due to fuel starvation was the last thing we needed at this point. The set up for a landing at night in the middle of the Cuxhaven port area was completed and my student and I were back in the game. The landing itself was uneventful, especially with the prehistory. Safe on the ground we breathed a sigh of relief. What happened? I made a fundamental mistake. In a critical moment I forgot my basic knowledge and skills that a pilot learns and internalizes in the first flight lessons. Maintain aircraft control, analyze situation and take proper action. I neither kept the aircraft under control, nor did I correctly assess the situation and I also did not take the right measures. I rushed to take control of the aircraft without being prepared and ready. No instrument scan set up, I "blew" myself into spatial disorientation along with the left turn not noticing the rate of descend, losing control of the aircraft and building up a sink rate that should have led to an impact at this low altitude. Luckily it did not! I almost managed to not only kill me - again - but also my student. Your worst nightmare almost came true. How could this happen? At the time of this flight I had many years of experience as a flight instructor, had trained dozens of pilots and mastered many critical situations. And yet something was different. I had hardly flown this profile myself in the months leading up to this flight, was completely occupied with other, mostly tactical training flights, and lost what we call my currency. The “practice” if you will. During this time, we introduced a new type of our aircraft and I was one of the two flight instructors who created and carried out the entire training on this type. In addition, there was hardly any time for the “other” sort of aviation. So it happened that, when it mattered most, I was unable to recall and apply what I had learned. I lacked the practice and also forgot the three basics in an emergency Maintain aircraft control analyze situation take proper action Three simple actions that save your life when in doubt I was lucky that once again it seemed as if my time wasn't there yet. Lesson learned? What does all this have to do with error management? Good question! In the fourth and concluding part of this series on error management, I will summarize and establish a connection to today's organizations and error culture. One thing can already be revealed at this point, I continued to fly after that night and my mistakes were not sanctioned. However, I drew my personal conclusions and did not fly any of these training flights as a flight instructor until I was “current” again and felt comfortable. Food for thought! .

For many people and organizations I have come across with a strategy is a detailed plan to achieve a goal, conquer new markets and win customers. Every single step is prep-planned and everybody involved is briefed thoroughly. It all falls into place like a well designed machine in which one gear teethes into the other and the only principle that needs to be applied is to follow the plan. Well it is not and never will be. The way I have learned strategy and ever since applied it as an military operator as well as a leader in the aviation industry is that a strategy is there to allow decision making without continuous alignments between those involved and particularly those up in the hierarchy. Strategy allows those in the field to make decisions which are aligned with the big picture and hence are fast, focused and prepare the ground for flexibility and adaptability for those things which are unpredictable in a high dynamic environment as the ones we operated in. A strategy is not a plan which predetermines every single step and decision that needs to be made to accomplish the mission. A strategy is an open space for action Same goes for industry. As today's markets have become enormously dynamic with a high level of market pressure, it has become more and more unpredictable. Plans however, require predictability in order to work. If you cannot predict the market's next move you cannot be sure that the plan will work, hence you likely end up planning for the wrong market move and thus lose market share and increase inefficiencies. You simply waste time and money. In order to survive in this high dynamic environment, companies need to change their way of reacting to market demands. Faster, flexible and with the power of adaptability. In order to retain the required speed in decision making to ensure adaptability and flexibility everybody in the organization is required to make decisions which are gearing into each other. That is why strategy work is everybody's business. If strategy is reserved to those in the upper level of the organization every decision will have to be checked with the hierarchy to ensure alignment of that decision and its implications with the strategy. The time needed for this alignment is simply not available and would above all imply an administrative burden to the organization. That is why strategy is everybody's business and not reserved for the upper hierarchy and require everyone to think. A strategy does not relieve anyone from thinking As predictability is absent and planning fails in high dynamic environments the strategy cannot make out steps to reach the goal or mission objective. The strategy is the space in which the tactics can function and it demands a high level of preparation from all involved. Operational decisions require the space of action to take place, which in turn places preparation over planning. Strategy requires preparation and is allergic to planning A good strategy increases the probability of decision making in the presence of a high dynamic and absence of predictability. Decision making which is done by everybody in the organization without continuous alignment with the hierarchy as the room of maneuver is clearly set and transported to everyone by the strategy. Hence the strategy can be seen as the pattern in the decisions made. Strategy is the pattern that can be seen in the decisions Formulating a strategy has to be done by excluding or explicite including formulations i.e. “ we are not xyz” or “ we are abc” and it is done in a way which prevents triviality like “ we want to play in the champions league….” or ..” we want to provide best quality we can…” Strategy formulation is not to be trivial As strategy work is not something that is exclusive to the upper hierarchy the strategy must be compatible with everybody in the organization, it has to resonate and make people want to follow. It has to resonate in order to let everyone swing into it. Strategy work is daily entrepreneurship by everyone in the organization. In a nutshell A strategy is an open space, a room to maneuver, limited by clear and tangible boundaries which allow daily decisions made by everyone involved in the organization to maintain speed, adaptability and flexibility in order to increase the probability of company success in the high dynamic of the market environment.

One day, one morning, two sunrises……..ever imagined the beauty of two sunrises in one morning? No? Me neither until I actually have experienced it. In fact it seems impossible does it not? How can you have two sunrises on the same day and morning? The sun rises and once it is up, it is up. Can´t turn it back down just for the sake of enjoying another one. Well, you can't push the sun back down, but you can change and alter your position and perspective to look at things. During one of my first deployments as a navy pilot I was introduced to the magic of two sunrises in one morning. Yes, it required a helicopter and good timing as well as the knowledge of some fundamental astrophysics about earth rotation ;-) Starting off at some altitude at the right time you see the sun coming up - 1st sunrise - before you do a rapid descent to around a 100ft above sea level to wait for the second rise - earth curvature and rotation will sort this out for you. And there you are, two sunrises in one morning. I admit, most of us will have difficulties getting their hands on a helicopter to make this happen, which is sad. But the point of the story is some things may seem impossible until you actually do them. some things remain out of reach, accept it. some things are not in your control, why bother? some things you cannot change, accept it and move on everything you see depends on your attitude everything you see depends on your perspective The magic in your life lies in you and your perspective and this is the only thing you can change. Don´t quit trying.....

Admittedly raising the voice and pointing out a mistake or error is something which seems not natural and common nowadays. Too much society seems to keep an overcoat above things which might go wrong or did go wrong. Feedback and error analysis degrades to a shower of wellbeing. The general tendency to a flawless world is overwhelming. And some factors why silence wins over voice so often is that silence has immediate benefit to oneself whereby voice may not create that individual benefit but more one for the team which is psychological not immediately favorable for humans. And also speaking up does often bring benefits with some time delay. But errors do occur! And the first thing that is crucial is to accept that fact. In order to reduce the number of mistakes to be made, this acceptance is the first and most important step. If you can not accept the fact that there will be things that go wrong and errors will be made, you cannot deal with these when they show up and shit is likely to hit the fan. At least this was likely flying a mission. A big part of our preparation as aircrew was to accept the presence of errors and to talk about them. No mission, no deployment had been possible without the ability to accept and manage errors. With the mutual acceptance that errors can occur among the aircrew we prepared the ground for the next element which is paramount in error management: Open your mouth and say it when you see it coming Some of the devastating accidents in aviation history happened because someone did not say something, did not open the mouth pointing out the mishap that was about to happen and did not raise a concern about the situation. Somebody saw the signs and yet kept silent. We could not afford silence over a voice pointing out things that weren't right. In the late 70s the fundamental basis of dealing with errors - alongside other things - was introduced in aviation and has been the backbone of how aircrew military or commercial has been working ever since. This backbone is CRM - Crew Resource Management. CRM gave us the structure to deal with errors. CRM has been introduced to numerous areas of industry and teams as the backbone of their daily collaboration. But beside this procedural element managing errors there was something else. Something which was of greatest importance not only when it came to managing errors but an element without which we hadn't been able to do what we had to do, to achieve our mission objectives as a team in a high pressure scenario. And this element is psychological safety. Psychological safety is the grounds to high performance in which everybody can speak up and raise any concern. No error management = no high performance as a team. So in raising the psychological safety leaders lower the threshold for team members to speak up and raise concerns which in turn will reduce errors to be made. How did we create an environment that allowed psychological safety? precise mission analysis so that everybody knows what's coming be clear on the situation of the crew self-awareness in the crew recognize crew members as human beings foster asking questions and actively request them take every perspective serious and into account before making a decision keeping your own mouth shut while listening to your crew members This is what we institutionalized alongside crew resource management not only before the mission but throughout the mission and the aftermath. Error management is crucial in today's business environment and one pillar of high performing teamwork. And today's organizations are better off creating an environment which allows the team members to speak up, raise concerns and point out where the team runs into making mistakes. And today´s leaders should embrace such behavior and not take it personal even though it might be the first impulse. It is for the better good. Because in the end, the worst thing you can do is to keep your mouth shut

It's night, the waves below us are a good 4 meters high, the rain is literally whipping against the cockpit windows, so that the wipers become completely useless. At an altitude of 100 feet (almost 30 meters) above the water surface, we fly towards the mission. Somewhere at sea on the planet. There are three of us, the standard crew for an operation of this kind. Three people, each with our own values, with our own trust values, yes, and also with our own fears. And yet above all of this there is a common frame of reference, a common goal, the mission. The details of the mission are irrelevant. The situation is crucial. We don't know exactly what to expect, we're unsure. And yet there is no restlessness, no hectic pace, no hesitation. Collaboration in the cockpit is in the deep blue area of systems theory, knowledge matters. Well-engineered processes – checklists and internalized procedures – relieve us of a lot of coordination and communication. We face the surprises of a mission with creativity and intuition - welcome to the red world of the cockpit. In this "system" we are one, relying on one another and having the deepest trust in each other in the crew. And although we "cross-check" there is neither time nor space to check everything and everyone down to the smallest detail. We are forced to trust each other. There, on the horizon, a shadowy ship can be seen. Barely lit, the hull seems to be fighting its way through the stormy sea. With a swell of 4 meters, the bow of the ship comes a good 8 meters out of the water. That's our target. The assignment, the mission, rescue an injured person and return to our mother ship for medical treatment. Arriving at the ship, a medium-sized trawler, the next processes start, the procedures as we call them in aviation, the preparations to get the injured person from the ship to us on board with a rescue winch. A serious undertaking even under good conditions. But at night, heavy seas and an injured person in the stretcher, this situation becomes a thriller. And yet there is no nervousness, no hectic pace, no hesitation. Each of us knows what to do, everyone knows his and her task. There is no time and no space to control everything and everyone, we are forced to trust each other. Each movement practiced a thousand times, rolls into the next. An interplay of three individuals, brought together with one mission, one ambition. The helicopter struggles with the elements, the pilot on the right literally has his hands and feet full keeping the machine hovering to the left of the trawler while the operator - that's what we call the person who operates the rescue hoist - gets the winch ready and then “talks” to the pilot. Talking means that since the pilot himself has hardly any view of the trawler, which is standing diagonally below him, the operator must introduce the pilot by voice in such a way that the machine remains hovering over the trawler. And to do so until the injured person is in the stretcher. Depending on the practice of the ship's crew, this can take a while. Not to forget, we still have 4 meters of sea. The ship pitches up and down. Meanwhile, the left pilot continuously checks the helicopter's operating parameters, oil temperatures, gearbox temperatures, engine performance, etc... and most importantly, the environment around the helicopter. As far as this is possible under these conditions. And yet there is an impressive calm in the cockpit, no hectic, automated movements are carried out. There is a lot of communication, but not much talking. It's reduced to the essentials. We take care of each other. There is an atmosphere imbued with professionalism and trust. Everyone has a role, a task. No role, no task is duplicated. Everything is based on knowledge, ability and trust. The injured person is finally in the cabin with us and we slowly move away from the trawler. The story isn't over yet. We still have to find our mothership in the stormy sea and land safely on it. We are already 1 hour away. The fuel is enough for a little over 2 hours. Now it depends on the left pilot. He is responsible for navigation, radar and radio. Is the ship where it should be? What if not? How long does the fuel last again? Where can we refuel? Is the ship where it should be? Another 30 minutes of flight go by, the first contact with the mother ship. They steam towards us. We are directed by the ship controller. From now on he tells us how to fly. Another player in the close network of cooperation. Altitude, speed, course, all under his directive. There is no rush, no unrest, we have to trust each other. The sea is still heavy and the boat - that's what we call our ship among us aviators - pitches heavily through the sea. The stern comes dangerously far out of the water. So that's where we're supposed to land?! Trained hundreds of times...let's go! And then we're next to the ship, next to the flight deck, on the left. The right pilot keeps the machine hovering next to the deck and waits for the flight deck officer to visually instruct him. The flight deck officer is the one who watches the movement of the ship on the flight deck and waves to the pilots at the precise moment the ship is steady in the water. He's the only one who can fully assess the entire situation of the ship's movements. Only the signals of the FDO - Flight Deck Officer - count in cooperation with the right pilot. The fifth player in the collaboration. And there is no rush, no unrest, we trust each other. After a few minutes of battling with the elements, the helicopter is safe on deck and with it we are safe on deck. And the injured person can finally go to the medics for the necessary treatment. We shut down the engines, pack our gear and get out. Our work is done. Relief sets in and there is hearty laughter for the first time in several hours. Good things have been done! Mission completed! And the moral of the story? The takeaway? Teamwork in an extreme situation, admittedly. But the principles of good teamwork are the same everywhere. There is a lot that can be dispensed with in teamwork but not trust. Trust is the basis of every good and successful cooperation. We are not all the same, we all have our characteristics, our flaws but one thing we must have in teamwork is trust. Without this trust we would not have been able to achieve this type of cooperation. We would have endangered ourselves through the lack of trust, since there was simply no room for distrust and micro-management. Mutual care was there to protect us, to take care of each other. But mistrust and control were out of place. In 20 years as a naval aviator flying helicopters I have learned one thing if nothing else……in leadership and teamwork everything may be dispensable but not trust…… That I have made as one of my principles in leadership coaching……trust based leadership and teamwork is vital. .

Ever thought about your values? No? It's rarely something we think about, but when it matters, it's good to know them. Like fingerprints we all have values but nobody has the same. Did you ever consciously think about your values and what they mean to you and even more importantly, where they came from? No? It's worth taking a look! I believe in my values, I believe in a person's value system and its influence on our actions. I have had many experiences in my life in which my value system played a major role. It has unconsciously guided me in all areas of my life. One´s values lie deep in our minds and guide us subconsciously in our daily life. Sometimes we feel them when we talk about our principles. Our values are shaped by the experiences in our lives. They are not rigid and unchangeable, but constantly adapt with our experiences. However, I believe that as we get older, it becomes more firmly and firmly anchored in us. Values play a role in all areas of our lives. Be it in the family, in the circle of friends and also in the professional environment. Our values are our inner mirror, on which we reflect and evaluate our environment, our experiences, but also the people we have contact with. They are our inner guide, our compass. They also influence our behavior in our environment in interaction with other people. And often, although unconscious, they are the reason for conflict. Studies prove that there are around 10 basic values which are shared among humans no matter which culture. Of course in different markedness but still we share the basis of values all long. Fascinating isn't it? Do you know your values? Then consciously deal with the question and write down your 5 values in life. What is important to you? What do your values mean for your actions and being? Where did they first emerge? In what situation were your values violated? Ever thought about it? No? Then just give it a try and consciously deal with your values and your behavior in relation to your values. Interesting insights often emerge. Only those who know his/her values can adapt his/her action in interaction with others. Can achieve a higher level of mindfulness and ease of mind. And studies show that resilience improves when one's own values are known. A Harward Business Review study reveals that high ethical standards are the most expected trades of a good leader. So leadership is about values. Values are also an important pillar of cooperation in a team context. Some claim that no team has the same values. I do agree. Anyone who hopes or even intends to do so will inevitably be disappointed. Nor is it the goal for everyone in the team to have the same values. Our imprints in life are too different. A well-functioning team does not necessarily have to share all values. However, it is an advantage to know each other's values. This is less about the comparison of content and more about mindfulness. Mindfulness towards the people with whom you work intensively every day. If I know the values of my colleagues, I can deal with them carefully and avoid violating them. In my experience, violations of one´s values are one of the most profound "violations" of our basic trust when interacting with other people. Causes a lot of damage to the trust base. And that is vital for team success and leadership. No trust = no leadership, no trust = no teamwork. My time as a navy pilot has shown me what trust in teams and leadership really means when things get tough. Dealing with values is an elementary part of my work as a coach, and I've only had good experiences with it. In the team workshops that I facilitate I always address in one way or the other the topic of values. Especially when it comes to inner satisfaction and fulfillment, dealing with one's values is of great importance. Try it, it's worth it. Take your time and discover your inner world of values. Don´t do it in between. Don´t do it when you are exposed to stress. You might want to seek support. From a good friend or perhaps a coach. Or give me a call and let us discuss how I can be of assistance in your team work.

Es gibt viele sogenannte Morgenroutinen und es gibt noch mehr Coaches, die diese bewerben und für die einzig wahre Routine erklären, die überhaupt einen guten Start in den Tag erlauben. Nun, vielleicht reihe ich mich hier gleich ein und erkläre Ihnen, wie Sie ab heute Ihren Tag beginnen müssen. Ich habe in den 18739 Tagen seit meiner Geburt im Januar 1971 einige Routinen entwickelt, die mir den Start in den Tag ermöglichten. Zugegeben, anfangs war ich nur als Alarmgeber eingebunden und habe meine Mutter nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es an der Zeit für die nächste Babynahrung ist. Mit zunehmendem Alter und Eigenständigkeit wuchsen auch die externen Einflüssen auf meine Tagesablauf und damit auf die Art und Weise, wie ich meinen Tag beginne. Als Schüler sah dieses noch einiges anders aus als es als Pilot z.B. an Bord einer deutschen Fregatte im Einsatz der Fall war. Fremdbestimmt und getrieben fühlten wir uns in den Einsätzen und wenig Herr bzw Frau unseres eigenen Ablaufs im Tag. Morgens durch die zärtliche Stimme des Wachoffiziers geweckt gab es einen strikten und klaren Ablauf des Aufstehens und Tagesbeginns. Nun, gut 10 Jahre später habe ich mir angewöhnt, meinen Tag etwas anders zu beginnen. Und zugegeben, so, wie mein Tag derzeit beginnt, hat es sich erst Anfang 2021 gestaltet. Aus der “Not” heraus geboren, Im Februar 2021 stolperte ich in eine berufliche und private Krise. Auf meiner Suche nach einem Weg heraus lief ich einem altbekannten Inspirator über “den Weg”. Bodo Janssen. In seinem Buch “Stille” lädt Bodo Janssen ein, in der Stille die Veränderung zu suchen. Da ich Bodo Janssen aus anderen Anlässen bereits kannte und seine Art Dinge zu denken und zu leben sehr schätzte, nahm ich die Einladung an und begab mich auf eine Reise in die Tiefe meiner Ruhe. Nun, zunächste war es eher die Tiefe meiner Unruhe. Zu fremd erschien es, seine Gedanken an sich vorbeiziehen zu lassen. Aber, es gelang mir von Woche zu Woche besser die Stille zu genießen. Diese Reise beginnt seither jeden Morgen mit einem Moment der Stille. Manche nennen es Meditation, gegebenenfalls ist es das auch, gleichwohl ich mich nicht als meditativ bezeichnen würde. Aber, am Ende ist es auch von geringer Relevanz ob oder ob nicht, wichtig ist, dass es mir gut tut. Und darauf wäre ich vor meiner Krise nie gekommen. Obwohl meine damalige Partnerin sehr tief in der Mediation zu hause war, habe ich es nie ausprobiert. Manchmal braucht es einen ordentlichen Schlag, um neue Weg gehbar erscheinen zu lassen. Diese Schlag hat mich Anfang 2021 sehr kalt erwischt. Anyway, zurück zur Morgenroutine, ich nehme mir 15 Minuten Zeit der Stille und stelle mir danach 3 Fragen und schreibe sie in ein kleines schwarzes Büchlein Wofür bin ich dankbar? Welche Chance werde ich heute nutzen? Welche Einstellung wähle ich heute? Trivial oder? Aber sehr sehr wirksam. Zumindest bei mir. Die bewusste Auseinandersetzung mit sich und seinen Einstellung zu sich selbst und seiner Umwelt ist ein mächtiges “Werkzeug” zur Erlangung innere Ruhe und damit Energie zu tanken. Nach den Fragen gibt es einen unverzichtbaren und sehr bodenständigen Morgenkaffee. Ohne den würde jegliche Wirkung verpuffen! So beginnt mein Tag seit gut einem Jahr. So werden auch die kommenden Tage beginnen. Warum? Weil es mir gut tut. Und dazu lade ich Sie ein. Eine Einladung es Auszuprobieren. Wenn es gefällt, großartig! Dann bleiben Sie dabei. Wenn nicht, dann versuchen Sie eine leichte Anpassung und schauen, ob es Ihnen mehr zusagt. Und wenn nicht, dann testen Sie etwas anderes. Wichtig ist nur, bleiben Sie bei sich und hören Sie in sich hinein was Ihnen gut tut und Energie gibt. Seien Sie achtsam und das den Tag hindurch. Mit der Übung kommt die Routine und es geht schlagartig alles sehr natürlich. Unser Körper und unsere Seele sind kostbare und unverzichtbare Ressourcen. Gehen Sie behutsam und achtsam damit um. Sie müssen ein Leben lang halten. In diesem Sinne, seien Sie achtsam! .

Mit den Werten ist es, wie mit der Blutgruppe. Man macht sich selten Gedanken darüber, aber wenn es darauf ankommt, ist es gut sie zu kennen. Ich glaube an meine Werte, ich glaube an das Wertesystem eines Menschen und dessen Einfluss auf unser Tun. Ich habe in meinem Leben viele Erfahrungen machen dürfen, in denen mein Wertesystem eine große Rolle gespielt hat. Sie haben mich in allen Bereichen unbewusst geführt. Es lohnt sich ein Blick auf die eigenen Werte. Jeder Mensch hat ein Wertesystem, hat eigene innere Werte. Ob bewusst oder nicht. Sie sind da. Geprägt werden unsere Werte durch die Erfahrungen und Erlebnisse in unserem Leben. Sie sind nicht starr und unveränderlich, sondern passen sich mit unseren Erfahrungen immer wieder an. Jedoch glaube ich, dass sie mit zunehmendem Alter fester und stärker in uns verankert. Werte spielen in allen Bereichen unseres Lebens ein Rolle. Sei es in der Familie, im Freundeskreis und auch im Berufsumfeld. Unser Werte sind unser innerer Spiegel, an dem wir unsere Umwelt, unsere Erlebnisse aber auch die Menschen mit denen wir Kontakt haben spiegel und bewerten. Sie sind unser innere Guide, unser Kompass. Auch beeinflussen sie unser Verhalten in unserer Umwelt in Interaktion mit anderen Menschen. Kennst du deine Werte? Nein? Dann setze dich einmal bewusst mit der Frage auseinander und notiere deine 5 Werte im Leben. Was ist dir wichtig? Was bedeuten deine Werte für dein Tun und Sein? In welcher Situation wurden deine Werte einmal verletzt? Schon einmal darüber nachgedacht? Nein? Dann probiere es einfach mal und setze dich bewusst mit deinen Werten und deinem Verhalten in Bezug auf deine Werte auseinander. Es kommen oft interessante Erkenntnisse heraus. Auch im Teamkontext sind die Werte eine wichtige Säule in der Zusammenarbeit. Manche behaupten, dass es kein Team mit gleichen Werte gibt. Dem stimme ich zu. Wer das hofft oder gar beabsichtigt, der wird zwangsläufig enttäuscht. Es ist auch nicht das Ziel, im Team alle die gleichen Werte zu haben. Zu unterschiedlich sind unsere Prägungen im Leben. Ein gut funktionierendes Team muss nicht unbedingt alle Werte teilen. Jedoch ist es von Vorteil, die gegenseitigen Werte zu kennen. Hier geht es weniger um den inhaltlichen Abgleich, sondern um Achtsamkeit. Achtsamkeit den Menschen gegenüber, mit denen man täglich intensiv zusammenarbeitet. Wenn ich die Werte meiner Kolleginnen und Kollegen kenne, kann ich achtsam damit umgehen und Werteverletzungen vermeiden. Werteverletzungen sind aus meiner Erfahrung mit die tiefgreifendsten “Verletzungen” unseres Urvertrauens in der Interaktion mit anderen Menschen. In meiner Arbeit als Coach ist die Auseinandersetzung mit den Werten ein elementarer Bestandteil, und ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht. Gerade wenn es um die innere Zufriedenheit und Erfüllung geht, ist die Auseinandersetzung mit seinen Werte von großer Bedeutung. Probiert es aus, es lohnt sich.

Dieser Artikel ist kein wissenschaftlicher Beitrag oder gar eine Studie. Es ist reine Erfahrung aus meinem Berufsleben, ein etwas anderer Blickwinkel auf die Systemtheorie gewürzt mit ein wenig Witz. Der Titel des Artikels mag schon befremdlich klingen….Was hat Niklas Luhmann mit der Fliegerei zu tun? Und was mag mich getrieben haben, diesen Artikel und diese Querverweise von der Fliegerei zur Systemtheorie Luhmanns herzustellen. Nun, in allen meinen Beiträgen versuche ich die Welt der Fliegerei mit der Welt der Führung und Organisationen zusammenzuführen und entsprechende Bezüge herzustellen, um unter anderem zu zeigen, dass die Herausforderungen der Führung in der Wirtschaft denen im Militär sehr ähnlich sind. Gleiches gilt für die Führungsprinzipien und Methoden. New Work und agiles Arbeiten existiert auch im Militär, so überraschend das dem einen oder anderen auch erscheinen mag. Ich habe in den vielen Jahren, in denen ich in der Wirtschaft Führungspositionen innehatte, festgestellt, dass die Effekte und Mechanismen sowie Methoden durchaus vergleichbar sind. Teilweise haben wir sie in der Fliegerei nur stringenter und konsequenter ein- und umgesetzt. Da ich mich seit einiger Zeit aus Interesse und mittlerweile berufshalber mit der Systemtheorie und deren Anwendung in der Beratung auseinandersetze, lag bzw. liegt es für mich nahe, auch einmal einen Versuch zu unternehmen, die Systemtheorie ins Cockpit eines Hubschraubers zu spiegeln. Denn sie hat selbst im Cockpit ihren berechtigten Platz. Ein kurzweiliger Exkurs in die Welt der Hubschrauberfliegerei mit Niklas Luhmann. Wer war Niklas Luhmann? Niklas Luhmann war ein deutscher Soziologe und Gesellschaftsforscher, der als bekanntester Vertreter der Systemtheorie gilt. Die Systemtheorie beschreibt auf ziemlich abstrakte Weise, wie Teams und Organisationen arbeiten bzw. wie Menschen sich in diesen verhalten. Diese Darstellung ist sicherlich stark vereinfacht, reicht aber für den Kontext dieses Artikels völlig aus. Abgeleitet wurde durch Dr. Gerhard Wohland daraus eine Differenzierung im Unternehmenskontext zur Problemlösung in rote und blaue Probleme. Der Bezug auf Probleme ergibt sich aus dem Zusammenhang von Organisationen in Unternehmen und deren primärer Aufgabe, Probleme zu lösen. Probleme lassen sich in blaue – grob beschrieben technische Probleme, kompliziert – und in rote – grob beschrieben dynamische, nicht festgelegte Probleme, komplex – unterteilen. Es gibt Problemstellungen, die einen roten und einen blauen Anteil haben. Blaue Probleme lassen sich durch Wissen lösen (Prozesse), wohingegen rote Probleme aufgrund ihrer Komplexität nur durch Können (Information, Übung) gelöst werden können. Und was bedeutet das für Unternehmen oder besser gesagt deren Organisationen? Dynamik-robuste Unternehmen bzw. Organisationen folgen nicht mehr dem klassischen Ansatz des Taylorismus. Vielmehr strukturieren sie sich so, dass sie möglichst schnell auf die Dynamik des Marktes reagieren können. Führung tritt in den Vordergrund, die klassische Steuerungsphilosophie des Taylorismus verliert an Wirkung. In diesem Kontext steht auch die Aufteilung in blaue und rote Welten bzw. Probleme. Es gibt hierzu einige gute Darstellungen im Internet. Siehe hierzu auch www.dynamikrobust.com oder auch www.intrinsify.de . Was hat das Ganze mit der Fliegerei zu tun? Wer Hubschrauber fliegen will, muss den Hubschrauber dazu bringen, genau dies zu tun. Jeder Hubschrauber ist im Grundsatz ähnlich konstruiert und basiert auf dem Prinzip eines Kraftaufwandes, um Gravitation und Luftwiderstand zu überwinden. Dazu bedarf es Energie in Form von Verbrennung in einem oder mehreren Triebwerken. Wer die Technik des Hubschraubers nicht kennt, der wird recht bald und zwangsläufig überrascht. Es entsteht also das Problem, den Hubschrauber dazu zu bewegen, den Boden kontrolliert zu verlassen und seine Besatzung dabei nicht umzubringen. Anhand dreier Beispielsituationen können wir zwischen blauen und roten Problemen unterscheiden. Beispiel 1 Der Versuch, die Triebwerke des Hubschraubers zu starten, wird nicht gelingen, wenn das dazugehörige Wissen nicht vorhanden ist. Mit Können hat das Starten der Triebwerke nichts zu tun. Das Anlassen der Triebwerke ist zwar nicht trivial, aber dennoch technisch klar und eindeutig beschreibbar und damit nur kompliziert und beherrschbar. Technisch und physikalisch lückenlos und nachvollziehbar beschreibbar, ist es ein blaues Problem. Gelöst wird dieses Problem – Anlassen der Triebwerke – durch das Wissen, welches in Form eines Prozesses – hier die Checkliste zum Anlassen der Triebwerke – konserviert wurde. Das Wissen steht der Organisation Besatzung also zur Verfügung. Dies gilt im Übrigen für den gesamten Ablauf bis zum eigentlichen Abheben des Hubschraubers vom Boden. Alle bis dahin zu lösenden Probleme, Anlassen der Triebwerke, Systemchecks etc., sind technisch einwandfrei und lückenlos beschreibbar und damit nur kompliziert und beherrschbar. Keinesfalls, gleichwohl es Außenstehenden bei der Beobachtung des Geschehens so erscheinen mag, sind diese Probleme dynamisch, überraschend und komplex und damit unbeherrschbar. Gut, zugegeben, wenn ich mich an meine Ausbildung zurückerinnere, dann erschien mir damals durchaus die Technik der Systeme als unbeherrschbar. Das lag aber wohl mehr an meinem Vermögen bzw. damaligen Unvermögen, die Dinge zu greifen. Aber sie bergen grundsätzlich keine Überraschungen. Wir befinden uns also in der tiefblauen Welt der Problemlösungen. Dies ändert sich schlagartig in dem Moment, in dem wir den Hubschrauber vom Boden abheben lassen. Besser gesagt, zwingen wir den Hubschrauber, den Boden zu verlassen. Im Gegensatz zu Flugzeugen, mit denen Sie in Ihren Sommerurlaub fliegen, will ein Hubschrauber eigentlich nicht fliegen. Er muss dazu gezwungen werden. Aber zurück zur roten Welt. Beispiel 2 Die Aerodynamik und der Flug eines Hubschraubers sind voller Überraschungen, hoch dynamisch und komplex. Sie können nicht vollends theoretisch beschrieben und vorhergesagt werden. Damit ist die Bedingung der roten Welt der Probleme erfüllt und wir müssen uns etwas anderes als Prozesse und Verfahren überlegen, um das Problem „Wie halten wir den Hubschrauber in der Luft ohne zu sterben?" zu lösen. Dies geht, wie wir ja bereits gelernt haben – rote Probleme sind nur mit Können lösbar –, nur mit dem Können des Piloten. Dieses Können hat er/sie sich über lange Zeit durch Üben angeeignet. Es ist wie Fahrradfahren: Der Grund, warum Sie nicht umfallen, ist, dass Sie intuitiv die richtigen Maßnahmen treffen; Ihr Körper reagiert, ohne dass Sie darüber nachdenken müssen. Sie nutzen Ihr Talent, Ihr Können, um Rad zu fahren. Gleiches gilt für das Fliegen eines Hubschraubers. Talent und Können, zugegeben vielleicht länger geübt als das Radfahren, führen dazu, dass wir vom Boden abheben und nicht abstürzen. Auch das Zusammenspiel der Besatzung basiert auf der Differenzierung von roter und blauer Welt. Vieles im Cockpit ist durch Prozesse (sogenannte Verfahren und auch Checklisten) geregelt und die dazugehörigen blauen Probleme sind gelöst. Dazwischen gibt es jedoch einige rote, hochdynamische Bereiche, wie z. B. eine taktische Lage im Einsatz. Diese ist dynamisch, voller Überraschungen und kann daher nicht mit Prozessen gelöst werden. Sie besteht aus vielen verschiedenen Teilen, z. B. Schiffen, Flugzeugen und Hubschraubern etc. Diese werden überwiegend von Menschen geführt bzw. gesteuert. Also sind wir hier wieder im Bereich sozialer Systeme à la Systemtheorie. Das Verhalten dieser Menschen in dem sozialen System „Einsatzlage" ist, Sie werden es ahnen, komplex und nicht eindeutig vorhersehbar. Gleichwohl die taktische Lage natürlich meist einer Strategie unterliegt, die durch Prinzipien (z. B. die Rules of Engagement) begrenzt wird, ergibt die reine Anwendung dieser Prinzipien keine eindeutige Vorhersagbarkeit. Es gibt ein Ziel, aber keinen festgelegten Weg, dieses zu erreichen. Auch wenn es blaue Anteile bzw. blaue Lösungsangebote in Form von taktischen Verfahren gibt, lässt sich eine taktische Einsatzlage nicht vorhersagen. Sie ist voller Überraschungen. Hier kommt es also wieder auf Können und Intuition der beteiligten Menschen, z. B. der Besatzung, an, möglichst Lösungen zu finden und flexibel auf die sich ständig ändernde Lage zu reagieren. Wieder sind wir in der roten Welt. Beispiel 3 Irgendwann geht jeder Einsatz zu Ende. Spätestens wenn der Kraftstoff zur Neige geht, muss an die Rückkehr gedacht werden. Die Landung ist, wie das Abheben auch, ein rotes Problem, welches es zu lösen gilt. Und je nach Wetterlage kann dieses rote Problem ein durchaus beängstigendes Problem darstellen. Ergo: Es ist wieder an der Zeit, auf das Können des Piloten zu vertrauen und zu hoffen, dass dieses Können durch genug Training in den vergangenen Monaten auf ein ansprechendes Niveau gehoben wurde. In den meisten Fällen ist das so. Gelandet heißt es in gewohnter Manier: „back for Tea and Medals". Das Abstellen der Triebwerke nach der Landung ist wiederum ein blaues Problem und wir greifen da beruhigend zur Checkliste (Prozess). Die Nachbesprechung nach der Landung ist zwar nirgendwo festgeschrieben, steht in keiner Checkliste etc., jedoch ist es ein ungeschriebenes Gesetz. Die Systemtheorie lässt abermals grüßen und verabschiedet sich damit zum Mittelwächter in die O-Messe (was das alles zu bedeuten hat, erkläre ich in einem der nächsten Beiträge). Warum nun das ganze Tam-Tam? Natürlich sind die Beispiele bewusst plakativ gewählt. Und doch steckt ein durchaus ernster Hintergrund in dem Ganzen. Die Moral der Geschichte ist: Die Systemtheorie ist allgegenwärtig – und sie funktioniert. Selbst in der Welt des Militärs und der durch mich selbst erlebten Hubschrauberfliegerei ist sie präsent. Daher sollte dieser Artikel einen anderen Blick auf „meine" Fliegerei und die Systemtheorie bieten, in der Hoffnung, neue Denkanstöße zu geben. Es lohnt sich ein näherer Blick auf die Mechanismen und deren Bedeutung für die heutigen Organisationen bzw. Unternehmen. Der ständige Ruf nach mehr Effizienz scheint ein naheliegendes Bedürfnis zu sein, trägt Unternehmen aber nicht in die Zukunft. Vielmehr sind Antworten auf die hohe Dynamik zu geben. Diese sind aber mit klassischen Denkmustern nicht zu entwickeln. Und wenn das Militär die Systemtheorie umsetzt, dann können bzw. sollten das moderne wirtschaftliche Unternehmen doch allemal, oder nicht? Vielleicht haben Sie diesen kleinen Beitrag mit Vergnügen gelesen. Vielleicht haben Sie auch den Kopf über so viel Unsinn geschüttelt. Aber mit etwas Glück regt er Sie auch an, die bekannten Pfade zu verlassen und die Organisation Ihres Unternehmens neu zu denken. Wie immer Sie diesen Beitrag auch wahrgenommen haben – eines erscheint mir jedoch sicher: Niklas Luhmann wäre ein guter Pilot geworden ;-)….

Teamwork – warum Vertrauen das einzige ist, was wirklich unverzichtbar ist Es ist Nacht. Die Wellen schlagen bis zu vier Meter hoch, der Regen peitscht gegen die Cockpitscheiben, sodass die Scheibenwischer völlig nutzlos sind. Wir fliegen in 100 Fuß (knapp 30 Meter) Höhe über die Wasseroberfläche, auf dem Weg zu einem Einsatz. Irgendwo auf diesem Planeten, mitten auf See. Wir sind zu dritt, die Standardbesatzung für Einsätze dieser Art. Drei Menschen, jeder mit eigenen Erfahrungen, Werten – und ja, auch mit eigenen Ängsten in dieser Situation. Und doch steht über allem ein gemeinsamer Bezugsrahmen: der Auftrag. Die Details des Einsatzes sind hier nicht entscheidend, wohl aber die Situation. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet, doch weder Unruhe noch Hektik kommen auf. Die Zusammenarbeit im Cockpit ist perfekt eingespielt. Systematische Abläufe und verinnerlichte Verfahren – wie Checklisten – reduzieren die notwendige Kommunikation auf ein Minimum. Überraschungen begegnen wir mit Kreativität und Intuition. In diesem „System“ sind wir eins. Wir vertrauen einander tief, trotz regelmäßiger Überprüfungen – „cross-checks“ im Fliegerjargon. Es bleibt weder Zeit noch Raum für Kontrolle im Detail. Wir müssen uns aufeinander verlassen. Da, am Horizont! Ein schemenhaft erkennbares Schiff kämpft sich durch die stürmische See. Es ist kaum beleuchtet. Der Bug hebt sich bei vier Metern Seegang immer wieder bis zu acht Meter aus dem Wasser. Das ist unser Ziel. Der Auftrag: den Verletzten bergen und ihn zur medizinischen Versorgung zurück zum Mutterschiff bringen. Am Schiff angekommen, einem mittelgroßen Trawler, beginnen die nächsten vorbereiteten Prozesse. Rettungswindenverfahren laufen an – bereits unter guten Bedingungen eine Herausforderung. Doch bei Nacht, schwerer See und einem Verletzten in der Trage wird es zum Drahtseilakt. Und wieder: keine Nervosität, keine Hektik. Jeder kennt seine Aufgabe. Alles läuft routiniert und nahtlos ineinander. Der rechte Pilot hat alle Hände und Füße voll zu tun, die Maschine stabil im Schwebeflug zu halten. Währenddessen macht der Operator die Rettungswinde klar und steuert den Piloten präzise über Sprache – das „Einsprechen“. Der linke Pilot überwacht parallel die Betriebswerte des Hubschraubers sowie die Umgebung. Die Bedingungen sind herausfordernd, doch die Kommunikation ist aufs Wesentliche reduziert. Es herrscht Ruhe, Professionalität und absolutes Vertrauen. Keiner kontrolliert den anderen – jeder übernimmt Verantwortung für seinen Bereich. Der Verletzte wird sicher an Bord geholt. Der nächste Schritt: unser Mutterschiff finden. Bei schwerer See und begrenztem Kraftstoff keine einfache Aufgabe. Nach 30 Minuten melden wir ersten Kontakt. Das Schiff dampft uns entgegen. Jetzt übernimmt der Schiffs-Controller. Er gibt Anweisungen zu Höhe, Geschwindigkeit und Kurs. Ein weiterer Spieler im eingespielten Teamwork. Trotz der schwierigen Bedingungen bleibt die Zusammenarbeit ruhig und koordiniert. Am Ziel angekommen, beginnt die heikelste Phase: die Landung. Das Schiff stampft durch die Wellen, das Flugdeck hebt und senkt sich bedrohlich. Der rechte Pilot hält die Maschine im Schwebeflug, während der Flugdeckoffizier – der einzige, der die gesamte Situation überblickt – die Maschine einweist. Nach Minuten konzentrierter Arbeit steht die Maschine sicher auf dem Deck. Der Verletzte wird in die medizinische Abteilung gebracht. Unsere Mission ist erfüllt. Erleichterung durchflutet die Crew. Nach Stunden angespannter Konzentration wird endlich gelacht. Es wurde Gutes getan. Die Moral der Geschichte Teamwork in Extremsituationen ist beeindruckend – doch die Mechanismen gelten überall. Alles kann verzichtbar sein – außer Vertrauen. Es gibt weder Raum noch Zeit für Misstrauen oder Micro-Management. Vertrauen ermöglicht echte Zusammenarbeit, in der sich jeder auf den anderen verlassen kann. Ohne dieses Vertrauen hätten wir die Mission nicht erfolgreich abschließen können – und uns vielleicht sogar selbst gefährdet. Vertrauen ist die Basis jeder erfolgreichen Zusammenarbeit. Alles andere ist ersetzbar – nur Vertrauen nicht. ...to be continued.

Die Frage nach Stärken und Schwächen – ein Plädoyer für Kontext und Menschlichkeit „Was sind Ihre Stärken? Und Ihre Schwächen?“ Diese Fragen begegnen uns in nahezu jedem Bewerbungsgespräch. Anfangs habe ich sie mit der gebotenen Ernsthaftigkeit beantwortet, immer darauf bedacht, die „richtige“ Antwort zu geben. Doch je intensiver ich mich – beruflich wie privat – mit menschlichen Eigenschaften auseinandersetzte, desto mehr begann ich, die Sinnhaftigkeit dieser Fragestellung zu hinterfragen. Heute bin ich überzeugt: Die pauschale Einordnung von Eigenschaften in Stärken und Schwächen wird weder der Komplexität eines Menschen noch dem Kontext einer Aufgabe gerecht. Stärken und Schwächen: Absolut oder kontextabhängig? Auf den ersten Blick erscheint die Antwort einfach: Stärken sind die Dinge, die wir gut können, Schwächen jene, die uns schwerfallen. Doch ist es wirklich so einfach? Diese Definition setzt voraus, dass Eigenschaften unabhängig von ihrer Umwelt bewertet werden können. Aber kann eine Eigenschaft tatsächlich eine Stärke oder Schwäche sein, ohne den Kontext, in dem sie sich zeigt, zu berücksichtigen? Menschen verhalten sich kontextabhängig. Wir agieren im Fußballstadion anders als im Boardmeeting, im Freundeskreis anders als bei der Arbeit. Diese Anpassung ist weder falsch noch unnatürlich – sie ist angemessen. Verhalten wird von der jeweiligen Situation geprägt, und diese beeinflusst auch, ob eine Eigenschaft als Stärke oder Schwäche wahrgenommen wird. Beispiel: Entscheidungsfreudigkeit ist in einer dynamischen, schnellen Umgebung oft eine Stärke. Doch in einem kreativen Brainstorming, das Geduld und Offenheit erfordert, kann dieselbe Eigenschaft hinderlich wirken. Umgekehrt mag Kreativität in einem stark prozessgesteuerten Umfeld weniger nützlich sein. Der Kontext entscheidet. Die Unsinnigkeit pauschaler Fragen Wenn Verhalten und Eigenschaften so stark von der Umwelt abhängen, wird deutlich, warum die Frage „Was sind Ihre Stärken?“ pauschal nicht sinnvoll beantwortet werden kann. Eine ehrliche Antwort müsste lauten: „Das hängt davon ab.“ Denn die Bewertung durch den Fragenden ist ebenfalls subjektiv. Sie basiert auf dessen Werte und Erfahrungen, die der Antwortende nicht kennen kann. Damit wird die Frage zu einer Übung im Spekulieren, die weder der befragten Person noch der Aufgabe gerecht wird. Eine neue Perspektive: Tieferes Interesse am Menschen Anstelle pauschaler Kategorisierungen sollten wir uns auf den Menschen konzentrieren. Warum hat eine Person bestimmte Entscheidungen getroffen? Was hat sie motiviert? Wie hat sie Herausforderungen gemeistert? Solche Fragen geben Einblick in Denkweise und Werte, sie fördern ein echtes Verständnis des Gegenübers. Eigenschaften lassen sich nur dann sinnvoll einordnen, wenn sie im Kontext der Aufgabe und des Teams betrachtet werden. Das erfordert eine systemische Perspektive: Organisationen und ihre Aufgaben sind Umwelten, die Verhalten und dessen Bewertung prägen. Was in einem Team als Stärke gilt, kann in einem anderen als Schwäche angesehen werden. Die Frage, ob jemand "passt", hängt also nicht von der Eigenschaft selbst ab, sondern davon, ob die Umwelt diese Eigenschaft wertschätzt und nutzen kann. Die Takeaways Kontext ist entscheidend: Eigenschaften sind weder absolut gut noch schlecht. Sie gewinnen Bedeutung durch die Umwelt, in der sie zum Einsatz kommen. Tiefer gehende Gespräche: Statt Stärken und Schwächen zu bewerten, sollten wir den Menschen verstehen wollen: seine Beweggründe, seine Denkweise, seine Anpassungsfähigkeit. Systemisches Denken: Organisationen prägen die Wahrnehmung und Bewertung von Verhalten. Die Passung einer Person ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Eigenschaft und Umwelt, nicht aus abstrakten Kategorien. Mein persönlicher Ansatz Auf die Frage nach meinen Stärken und Schwächen antworte ich seit Jahren: „Das kann ich Ihnen nicht pauschal sagen. Ich kann Ihnen beschreiben, wie ich bin und wie ich mich wahrnehme. Ob das eine Stärke ist, können nur Sie im Kontext der Aufgabe bewerten.“ Für manche Personaler:innen mag das provokant wirken. Doch ich bin überzeugt: Wir alle sind, was wir sind – einzigartig, komplex und wandelbar. Es ist an der Zeit, diese Vielfalt zu erkennen und die oberflächlichen Schubladen von „Stärken“ und „Schwächen“ hinter uns zu lassen. Denn nur so können wir den Menschen wirklich gerecht werden – und den Aufgaben, die vor ihnen liegen.
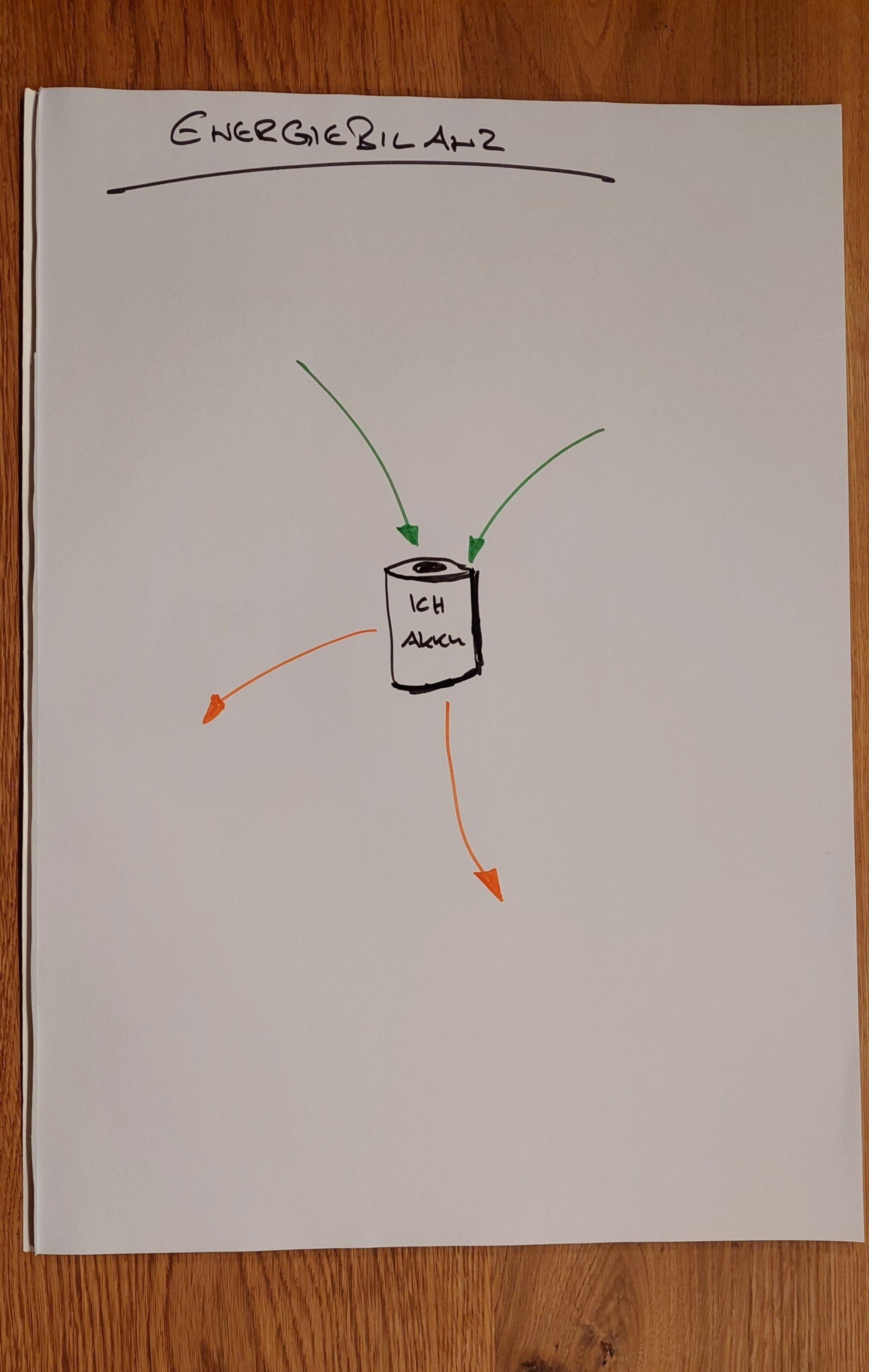
Wer kennt sie nicht, die Suche nach der richtigen Work-Life Balance? Ich hadere seit langem mit dieser Theorie. Work-Life Balance….was soll das eigentlich sein? Die Balance von Work und Life? Gehört Work nicht zum Life? Zumindest habe ich einen Großteil meines bewussten Lebens mit Work, also Arbeit verbracht. Ich stelle hier einmal provokant die These auf, dass das für den überwiegenden Teil der hier „Anwesenden“ gilt. Von daher muss die Frage gestellt werden, warum wir versuchen sollten, eine Balance zwischen Arbeit und Leben herbeizusehnen. Wo Arbeit doch ein Teil unseres Lebens ist, und unser Leben auch durch und über Arbeit besteht. Muss oder sollte das gesamte Leben eines jeden Menschen nicht in Balance sein? Ohne zu esoterisch wirken zu wollen, aber das Leben ist ein stetiger Fluss von Energie, unser Körper, unsere Seele. Ein feines Gleichgewicht von Energieabflüssen und Energiezuflüssen. Kennen wir nicht alle das Gefühl „Oh, das hat mich gepusht, das hat mir Energie gegeben!“ und auch das Gefühl, dass uns andere Dinge Energie genommen haben? Geht es also nicht vielmehr darum, die täglichen Energieabflüsse und -zuflüsse in Balance zu halten? Greift die Work-Life Balance dahingehend nicht zu kurz? Ich betrachte die Balance in meinem Leben seit langem differenzierter. Nicht alleine die Arbeit zieht oder gibt Energie. Alle Teile meines Lebens sind Energiegeber und -nehmer. Und das kann sich ändern. Unvorhergesehen und ohne mein Zutun. Manchmal ist es im Büro mit den Kollegen stressig und zieht mir Energie. Manchmal klappt es im Privaten nicht so glatt und benötigt etwas mehr Aufmerksamkeit und Energie. Manchmal hole ich mir Energie im Freundeskreis, die ich dann in anderen Bereichen meines Lebens brauche. Manchmal gibt mir der gute Tag mit Kollegen viel Energie, die ich in der Partnerschaft brauche. Manche stürzen sich nach Trennungen in die Arbeit, weil sie darin Bestimmung und Ablenkung finden… Sie finden in dem Moment Energie, die sie benötigen. Oder sie finden bei einem alten Freund Halt und Energie….oder der Partner ist die Batterie, an der man sich wieder auflädt, wenn es anderswo nicht gut läuft. Es gibt viele Beispiele für Energieabflüsse und -zuflüsse. Ich bin überzeugt, dass wir mehr Achtsamkeit für unsere tägliche Energiebilanz aufbringen sollten. Was gibt uns Kraft, was nimmt sie uns. Wie können wir die Dinge besser nutzen, die uns Kraft und Energie geben? Am Ende eines Tages, sollte der Energiehaushalt von Körper und Seele in Balance sein. Alarmierend wird es, wenn diese Balance dauerhaft nicht mehr gelingt. Dann droht der Kollaps. Ich möchte Sie einladen, einladen zu einer Intervention, die ich mit vielen meiner Kunden durchführe….die persönliche Energiebilanz. Zeichnen Sie Ihren „Ich-Akku" auf ein Blatt Papier und notieren Sie die Energieflüsse. Machen Sie sich bewusst, was hat Energie aus Ihrem “Ich-Akku” gezogen und was hat Ihrem „Ich-Akku“ Energie zurück gegeben? Machen Sie es täglich und schauen Sie am Ende der Woche auf die Wochenbilanz. Reflektieren Sie bewusst die Energiegeber und nehmen Sie sich vor, einen dieser Geber in den kommenden Tagen intensiver zu nutzen! Die Übung schärft die Achtsamkeit. Viel Spaß dabei!









